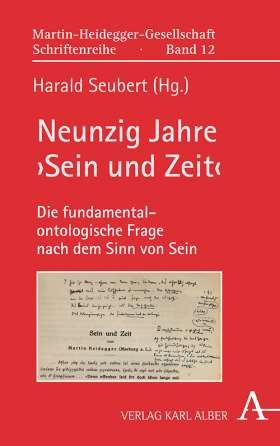Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben zahlreiche Impulse der Phänomenologie in Theorien des Bewusstseins, der Kognition, der Emotion und der sozialen Koexistenz Einzug gehalten. Husserls explizites Programm, wonach Phänomenologie transzendentale Philosophie sei, erfährt meist eine tendenziell „stiefmütterliche“ Behandlung. So lange die Phänomenologie dank ihrer leistungsfähigen Deskriptionen zu einer präziseren Stilisierung unserer epistemischen Ausgangslage und ihrer Implikationen beiträgt, sehen auch „naturalistische“ Verwender ihres begrifflichen organon großzügig über ihre „idealistischen“ Vermessenheiten hinweg. Doch die Zeit einer Marginalisierung ihres erkenntnislegitimierenden Anspruchs scheint vorbei – das „Transzendentale“ ist wieder ein aktuelles Diskussionsthema in der Phänomenologie, das „spekulative Format der Philosophie“ noch nicht überall zugunsten einer „Sensibilität für sanfte commitments“ (Wolfram Hogrebe) oder reiner „Archäologien von Sinn- und Seinsverständnissen“ (Sophie Loidolt) verabschiedet. Statt wie zahlreiche PhänomenologInnen Zugeständnisse an die Kritiker der transzendentalen Ausrichtung der Phänomenologie zu machen, wählt Alexander Schnell zur Vorstellung seiner „generativen Phänomenologie“ eine offensive wie eigenständige Strategie: Gerade die Radikalisierung ihres transzendentalen Anspruchs am Leitfaden einer konsequenten Kritik der Allgemeingültigkeit der Aktintentionalität soll im Kontext gegenwärtiger Philosophie-Diskurse ihre argumentativen Ressourcen verdeutlichen.
Wie also „die Welt als konstituierten Sinn konkret verständlich zu machen“ (Hua I, 164)? Ausgangspunkt des Ansatzes ist eine doppelte Perspektivierung des Phänomenbegriffs. Gewöhnlich adressiert Husserl das Phänomen als „das reine Erleben als Tatsache“ (Hua XXXV, 77), also als das Faktum des Erscheinens von Gegebenheiten für das Bewusstsein, samt deren reflexiv aufweisbaren Implikationen (Abschattung, Apperzeption, Protention, Retention, Auffassung/Auffassungsinhalt, etc.). Er stößt aber – vor allem in den Manuskripten zum inneren Zeitbewusstsein und zur passiven Synthesis – auf „Tatsachen […], die sich nicht in einem anschaulichen konstitutiven Prozess aufzeigen lassen“ (5). Solche „Grenzfakten“ verweisen auf „fungierende Leistungen“, welche das Erscheinen von etwas im Bezugsrahmen einer intentionalen Korrelation aber überhaupt erst ermöglichen, und sich somit als Phänomen sui generis melden – ohne sich durch die „Positivität“ eines „in ihm“ Erscheinenden ontologisch zu stabilisieren. Beispiel: Wird ein Ton in der Perspektive des ersten Phänomenbegriffs als Zeitobjekt deskriptiv analysiert, können beispielsweise „Retention“ und „Urimpression“ als präreflexive Implikationen der Konstitution eben dieses Tons aufgewiesen werden. Der zweite Phänomenbegriff verschiebt den Fokus auf die Konstitution der Zeitlichkeit der Retention selbst: Ist diese „objektiv“ oder „subjektiv, „beides“, oder „weder noch“? Wie kann ein deskriptiv-anschaulich nicht weiter Erschließbares dennoch transzendentalphänomenologisch fundiert und ausgewiesen werden? Hier verstrickt sich die deskriptive Analyse in Antinomien, welchen Schnell zufolge nur durch eine „konstruktiv“ erweiterte Methodologie beizukommen ist, mit der sich Zugang zu den ursprünglich konstituierenden Phänomenen gewinnen lässt. Denn: Es „muss mit aller Schärfe betont werden, dass das Feld des Transzendentalen sich nicht auf das in einer anschaulichen Evidenz Gegebene reduzieren lässt“ (5). Ansonsten bleibt transzendentales Philosophieren auch in seinem phänomenologischen Vollzug in einen vitiösen Zirkel gesperrt, da das Zu-Legitimierende – das im Rahmen einer intentionalen Beziehung zwischen einer „subjektiven“ und einer „objektiven“ Instanz Erscheinende – seinerseits als Legitimationsgrundlage veranschlagt wird.
Mit dieser Einsicht einer notwendigen „»Heterogenität« zwischen Bedingendem und Bedingten“ (42) hebt die generative Phänomenologie an; sie stellt sich im Grunde als Versuch dar, diese Heterogenität zwischen Weisen der Gegebenheit und der Nicht-Gegebenheit methodisch zu operationalisieren. Dementsprechend bezeichnet „Generativität“ das „Hervorkommen und Aufbrechen eines Sinnüberschusses jenseits und diesseits des phänomenologisch Beschreibbaren“ (1). Für die „Wirklichkeitsbilder“ ist dabei „diesseits“ die leitende Präposition: Als ein transzendentalphilosophisch in Anspruch nehmbares „Diesseits“ der bipolaren Dichotomien wie Subjekt/Objekt oder Bewusstsein/Welt soll sich hier die Grunddimension enthüllen, welche die „Genesis des Sinns“ (1) erzeugt und selbigen als „Spielraum“ (5) jedes intentionalen Bezogensein-Könnens konstituiert. Eine solche Genesis kann nicht als „Vermögen“ eines „präexistierenden Subjekts“ (4) angesetzt werden – zur Disposition steht nicht die Sinngebung eines Bewusstseins, sondern die Sinnbildung selbst. Folgerichtig stellt auch nicht das „Subjekt“ den „Ausgangspunkt“ des vorgelegten phänomenologischen Verfahrens dar, sondern „die so unaufhörliche wie rätselhafte Erzeugung und Bildung des »Sinns«“ (82). Zwar weist diese eine „subjektive“ Dimension auf, doch um die „Kohärenz eines »sich bildenden Sinns«“ nachzuvollziehen, bedarf es der Thematisierung einer reflexiven und pulsierenden Architektur, in der „ideale“ (auf subjektive Aktivität rückführbare) und „reale“ (aus der objektiven Äußerlichkeit hervorgehende) Elemente sich als „gleichsam organisches Netzwerk von »Fungierungen«, »Leistungen« und […] »Begriffen«“ (83) manifestieren. Auf dieser genuin transzendentalen, weil für die Sinnbildung letztkonstitutiven Stufe ist das Objekt nie „reines“ Objekt, das Subjekt nie „reines“ Subjekt – deren architektonischer Einheit, nicht deren intentionalem Gegenübersein „entspringt“ Sinn. Damit kommt ein „präimmanentes“, wechselseitiges Vermittlungsverhältnis ins Spiel, in welchem sich die intentionale Korrelation in actu ausdifferenziert: Nicht als „ein Hin-und-Her zwischen zwei bloß formal herausgebildeten Polen“ (197), sondern als „»anonyme« Genesis des »sich bildenden Sinns«“ (83). Diese ereignet sich in einer „nicht aufzuhebenden Spannung“ (206) zwischen einer „subjektiven“ und einer „objektiven“ Instanz – und damit „diesseits“ dieser Unterscheidung.
Von zentraler methodologischer Bedeutung sind nun „die jedem Sinnphänomen innewohnenden genetisch-imaginativen Prozesse“ (2). Diese gehen „konstitutiv jeglicher realen und faktischen Fixierung“ (18) voraus und ermöglichen, dass Sinn sich als der Spielraum der Weltoffenheit je schon schematisiert hat; ein Spielraum wohlgemerkt, den „jede objektivierende Wahrnehmung“, ja „jedes objektivierende Bewusstsein überhaupt“ (43), voraussetzt: „Diese »Selbst-Schematisierung« ist das eigentliche und ureigene Werk der Einbildungskraft […].“ (196) Als terminus technicus der generativen Phänomenologie bezeichnet die Einbildungskraft nicht ein subjektives Vermögen, sondern ein transzendentales „Verfahren zur Darstellung des Wirklichen“ (64), welches unablässig die Horizonte möglicher Gegenstandsbezüge des intentionalen Bewusstseins dadurch generiert, dass es „sowohl de[m] Überschuss des »Wirklichen« gegenüber dem »Bewussten« als auch de[m] Überschuss des »Erlebens« gegenüber dem »Objektivieren«“ (64) Rechnung trägt. Das Bild ist die Art und Weise, „wie diese Darstellung sich konkret vollzieht“ (64), da in ihm „Ich“ und „Nicht-Ich“ in ein „innerliches“, produktives Verhältnis gebracht und gehalten werden. Schnell bezeichnet diesen Umstand als eine durch die Einbildungskraft geleistete „Endoexogenisierung“ (26) des phänomenalen Feldes, eine Figur der Subjektivität, die an Heideggers Begriff des „ausstehenden Innestehens“ anknüpft. In ihr zeigt sich die nie zu fixierende „»Zweideutigkeit« zwischen einem »anonymen« und einem bestimmten »subjektiven« Charakter“ der Sinnbildung, eine „Doppelbewegung“ des „Schwebens“ oder „Schwingens“ „zwischen einer »endogenen« (Immanenz, Innestehen) und einer »exogenen« Dimension (Transzendenz, Ausstehen)“ (206).
Zur Untersuchung der „Regeln und Gesetzmäßigkeiten“ (89) der Genesis des Sinns entwickelt Schnell die „phänomenologische Konstruktion“ als „methodologische[n] Grundbegriff der neu zu gründenden transzendentalen Phänomenologie“ (37). Mit ihrer Hilfe soll „jegliche Faktualität in Bewegung“ versetzt werden können, „erzittern“ (6), um Zugang zu einer Konstitutionsstufe „diesseits des »Gegebenen« und des »Wahrgenommenen«“ (2) zu eröffnen. Die phänomenologische Konstruktion ist dabei eine „»generative« Verfahrensweise“ (5) – genauer: deren drei –, welche die „»bildenden« Prozesse“ zu Tage fördert, die dem „Haben“ eines „Realen“ oder eines „Gegebenen“ vor jeder faktischen „Absetzung“ zugrunde liegen. Als „Entwurf“ unternimmt eine phänomenologische Konstruktion den Versuch, die – phänomenologisch aufgefassten – transzendentalen Bedingungen des vom Phänomen Geforderten zu genetisieren. Die Ausgangspunkte phänomenologischer Konstruktionen sind die Endpunkte der deskriptiven Analyse. In einer Art (generativer) »phänomenologischer Zickzack-Bewegung«“ (38) suchen sie zwischen den „deskriptiv nicht weiter erklärbaren Phänomenen und eben dem zu Konstruierenden hin und her“ (150) zu „schwingen“. So soll das „wechselseitige Bedingungsverhältnis von Genesis und Faktualität“ (107) in eine Erfahrung transponiert werden. Diese weist eine transzendentale Struktur auf, dergestalt, dass sie sich als Ermöglichung der Möglichkeit des Ausgangspunktes realisiert. Ontologisch handelt es sich bei dem Zu-Konstruierenden weder um ein im Voraus Gegebenes, noch um eine allererst Hervorzubringendes, sondern um etwas, das einem anderen „architektonischen Register“ als dem intuitiv Individuierbaren, schon Konstituierten angehört, und der Unterscheidung zwischen Erkenntnistheorie und Ontologie vorausliegt. Mit dem Erfassen des Status dieser Methode steht und fällt das Vorhaben der „Wirklichkeitsbilder“: Ihrer Darstellung und Exemplifikation ist der in zehn Kapitel gegliederte Text im Wesentlichen gewidmet. Während die ersten drei Kapitel – „Einleitung“, „Phänomen und Konstruktion“, „Die Einbildungskraft“ – eine ideengeschichtliche Verortung sowie eine systematische Grundlegung der methodologischen Optionen leisten, „erproben“ die sechs folgenden Kapitel – „Das phänomenologische Unbewusste“, „Die Realität“, „Die Wahrheit“, „Die Zeit“, „Der Raum“ und „Der Mensch“ – das phänomenologische Konstruieren in Einzelanalysen. Hierbei werden jeweils phänomenologische Konstruktionen „vorgeführt“: Zwei nicht aufeinander reduzierbare, aber unverzichtbare epistemische Zugänge zum jeweiligen Thema werden phänomenologisch-konstruktiv um eine generative Grunddimension erweitert, die als Ermöglichung ebendieser Zugänge einsichtig wird. Das letzte Kapitel ist einer abschließenden wie ausblickenden Reflexion der Perspektiven gewidmet, die sich im Rahmen einer generativen Phänomenologie eröffnen.
Im ersten Kapitel wird dargelegt, weshalb sich die generative Phänomenologie jedem Versuch entgegenstellt – Schnell referiert als zeitgenössische Beispiele die Theorien von Claude Romano und Jocelyn Benoist –, „den Sinn in einem vorausgesetzten Realen“ (19) zu verankern. Vielmehr gilt es, die „Möglichkeit der Notwendigkeit“ (20) eines sich als real Darstellenden zu „be- und hinterfragen“ (20). Damit gerät die Aufgabe in den Blick, „die Notwendigkeit auf ihre eigene Notwendigkeit hin zu untersuchen“ (20): Die Frage ist nicht, wie sich ein sowieso notwendig Reales phänomenal bekundet, sondern wie sich die Notwendigkeit eines hypothetisch Realen phänomenalisiert. Sobald eine subjektivierte oder objektivierte „Fundierung“ der Notwendigkeit des Realen in Anspruch genommen wird – ob anschaulich beschreibbar, ob logisch oder spekulativ deduzierbar –, ist diese genuin phänomenologische Aufgabe übersprungen und der Begriff der Realität – konträr zu den Ambitionen jedes „Realismus“ – um seine Sachhaltigkeit gebracht. Um dem zu entgehen, bedarf es „jede einseitig ontologisch oder erkenntnistheoretisch ausgerichtete Verfahrensweise aufzugeben“ (22). Vielmehr erfordert das Programm der generativen Phänomenologie die Auseinandersetzung mit konkreten phänomenalen Gehalten, um „»eine transzendentale Erfahrung herauszustellen« und vor allem ein transzendentales Feld zu begründen, das diesseits jeder »anschaulichen« Erfahrung angesiedelt“ (24) und imstande ist, eine einem jeweiligen phänomenalen Gehalt angemessene „Fundierung ohne Fundament“ (22) zu leisten. Die Erschließung dieses „»anonyme[n]«, »präimmanente[n]«, »präphänomenale[n]« Feld[es]“ (26) verlangt Schnell zufolge eben jene „phänomenologischen Konstruktionen“, die er im Rahmen des generativen Ansatzes mithilfe der Feinabstimmung eines „spekulativen Transzendentalismus“ und einer „konstruktiven Phänomenologie“ zu entwickeln sucht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den phänomen- und erkenntnistheoretischen Grundlagen der konstruktiven Methodologie. Leitend ist dabei ein „Phänomenalitäts“-Typus, der „diesseits der reinen Gegebenheit in der immanenten Sphäre des transzendentalen Bewusstseins zu verorten ist“ (30). Als Pointe von im Detail doch sehr unterschiedlichen Ansätzen – Husserl, Heidegger, Kant – destilliert Schnell, dass es ein Phänomenalitäts-ermöglichendes Nicht-Erscheinen im Phänomen selbst gibt, von dem her sich das Phänomen überhaupt erst als Phänomen und nicht lediglich als unmittelbares Erscheinen eines objektivierten Seienden thematisieren lässt. Hier erweist sich die genuin „transzendentale Dimension des Phänomens innerhalb der Phänomenalität“: Es handelt sich dabei um jene „dynamische Dimension des Erscheinens, die sich nicht auf einen stabilen ontologischen Grund stützen kann“ (32) – nicht einmal auf eine fixe zeitliche Bestimmung –, und selbst nie als „Seinspositivität“ gegeben ist. Diese als „generativ“ ausgezeichnete Dimension in der „präimmanenten Sphäre des Bewusstseins“ (37) bietet Schnell zufolge die „Möglichkeit der Legitimierung des Sinns des Erscheindenden“ (37), ohne das transzendentale Bedingungsverhältnis qua Homogenisierung von Bedingendem und Bedingtem in einem vitiösen Zirkel zu de-plausibilisieren. Hierzu werden drei Gattungen phänomenologischer Konstruktion konzipiert. Phänomenologische Konstruktionen erster Gattung beziehen sich als „Genetisierung“ von Tatsachen auf einen präzisen Gegenstandsbereich, der auf der Ebene der immanenten Bewusstseinssphäre widersprüchliche „Fakta“ zeitigt, deren mögliche vorgängige Einheit in der präimmanenten Bewusstseinssphäre qua Konstruktion konkret ausweisbar ist. Die phänomenologische Konstruktion zweiter Gattung entspinnt sich zwischen „dem sich in der immanenten Bewusstseinssphäre darstellenden Phänomen“ (39) und dem virtuellen Horizont seiner Phänomenalisierung. Ihren Fokus bildet somit das „Aufbrechen der Genesis“ als Wechselspiel zwischen Vernichtung und bildendem Erzeugen, das als einheitliches Prinzip der Phänomenalisierung die Differenz zwischen Erscheinen und Erscheinendem konkretisiert. Eine phänomenologische Konstruktion dritter Gattung zielt auf die „ermöglichende Verdopplung“ (40) seines transzendentalen Bedingungsverhältnisses, also auf das Möglichmachen der Möglichkeit selbst. Damit realisiert sie die Einsicht, dass auf der transzendentalen Stufe der letztursprünglichen Konstitution des Sinnes des Erscheinenden die bedingende Möglichkeit sich selbst in ihrem Vermögen erscheint, das, was möglich macht, ihrerseits möglich zu machen.
Schnell exemplifiziert diese Bestimmungen im Entwurf einer generativen „Phänomenologie der Erkenntnis“. Erkenntnis als Erkenntnis ist nicht an einen bestimmten Gegenstand gebunden; zudem ist Erkenntnis nie thematisch und explizit gegeben, erscheint also nicht zusätzlich zu dem Wie des Gegebenseins eines phänomenalen Gehalts in der immanenten Bewusstseinssphäre. Damit stellt die Erkenntnis den Prototyp eines „unscheinbaren“ Phänomens dar, dessen spezifischer Phänomenalitäts-Typus sich nun qua phänomenologischer Konstruktion dritter Gattung ausweisen soll. Zuerst bilden wir uns einen „noch völlig leeren Begriff“ (43) dessen, was eine Erkenntnis als Erkenntnis auszeichnet. Unabhängig davon, wie viel inhaltliche Konkretisierung wir diesem Begriff beilegen, kommt er nicht umhin, sich als „bloße Vorstellung“ (43) zu reflektieren, nicht als tatsächliche Auszeichnung der Erkenntnis als Erkenntnis, sondern als ein „ihr gegenüberstehender Begriff davon“ (43). Um zur Auszeichnung selbst zu gelangen, muss das soeben Entworfene vernichtet werden. Es stellt sich also parallel zu jeder bloß projizierten Vorstellung ein „reflexives Verfahren“ (44) ein, das Schnell als genetischen Prozess von Erzeugung und Vernichtung bezeichnet. Anders formuliert: Im Auseinandertreten von angepeilter Auszeichnung der Erkenntnis als Erkenntnis und bloßer Vorstellung reflektiert sich die intentionale Struktur des Bewusstseins selbst. Diese Autoreflexion der Bewusstseinskorrelation ist nun genau in dem Maße präintentionales Bewusstsein, in dem sie weder ontologisch stabilisierbar noch zeitlich fixierbar ist. Damit erweist sich dieser durch die phänomenologische Konstruktion aufgedeckte „präintentionale Setzungs- und Vernichtungsakt“ (44) als konkrete Bedingung der Möglichkeit der Phänomenalisierung der Intentionalität, die eben gerade dadurch bestimmt ist, „dass das in ihr Konstituierte nicht in einem ihm Zugrundeliegenden fundiert ist“ (44). Wie ist es aber zu erklären, dass diese „zweifache entgegengesetzte vorsubjektive (und »plastische«) »Tätigkeit« eines Setzens und Aufhebens“ sich nicht einfach als „rein mechanische »Tätigkeit«“ (44) vollzieht, sondern sich bemerkt? Nur dadurch, dass sich die Reflexion der Vorstellung wiederum reflektiert, diesmal eben nicht als Reflexion der Vorstellung, sondern als Reflexion der Reflexion. Damit erschließt sich „das Reflektieren in seiner Reflexionsgesetzmäßigkeit“ (44): Es bekundet sich als Feld des „reinen Ermöglichens“ (45), das an keinem „je schon objektiv Gegebenem“ (44) haftet – weder an einem vorgestellten Gehalt auf der Ebene des immanenten Bewusstseins, noch an der Reflexion dieses Gehalts als bloßer Vorstellung. Diese Reflexion der Reflexion ist das „Urphänomen“ der Phänomenologie der Erkenntnis: Sie drückt qua „Sich-Erfassen als Sich-Erfassen“ das „reflexible »Grundprinzip« der Ermöglichung des Verstehens von…“ (46) aus – wodurch das Erkennen als Erkennen losgelöst von jedem konkreten Inhalt und damit als Phänomen sui generis auszeichnet wäre. Vor diesem Hintergrund formuliert Schnell das „transzendentale Reflexionsgesetz“, wonach „jedes transzendentale Bedingungsverhältnis seine eigene ermöglichende Verdopplung impliziert“. Die ermöglichende Verdopplung ist eine „produktiv-erzeugende Vernichtung“ (45): Sie vernichtet jede erfahrbare Positivität eines Bedingenden, und macht so ein Bedingtes möglich. Dergestalt weist das transzendentale Reflexionsgesetz nicht lediglich die Ermöglichung dieser oder jener konkreten Möglichkeit, sondern die Ermöglichung jeder Möglichkeit als Möglichkeit – und damit das „allgemeinste Prinzip“ jeder Erkenntnisbegründung – phänomenologisch aus.
Im dritten Kapitel steht die Einbildungskraft als Grundbegriff des transzendentalen Philosophierens im Mittelpunkt. Wie lässt sich am Leitfaden der Einbildungskraft und des Bildes „die Frage nach dem Status der intentionalen Korrelation“ (59) neu aufwerfen und beantworten? Zunächst ist die Korrelation keine „äußere“, die „Subjekt“ und „Objekt“ in ein Verhältnis „partes extra partes“ stellt, sondern sie zeichnet sich durch eine „apriorische Synthetizität“ ihrer Glieder aus. In der Korrelation werden „eine Dimension der »Innerlichkeit«, die dem wahrnehmenden Subjekt eigen ist, und eine Dimension der »Transzendenz«, die dem Wahrgenommenen zugehört, unzertrennlich zusammengehalten“ (62). Das Zugleich von Abstand und Verbindung zwischen Ich und Welt realisiert sich im Bild als „Vektor der transzendentalen Leistungen der Einbildungskraft“ (63). Anders als in der Wahrnehmung und im Urteil, wo stets etwas etwas „gegenüber“ steht, unterläuft die Einbildungskraft so die gängigen, bipolaren Beschreibungen der intentionalen Struktur wie Subjekt/Objekt oder Bewusstsein/Welt. Schnell formalisiert dies als den „doppelten Entwurf des »Anderen-für-das-Selbst« und des »Selbst-im-Anderen«“ (64). Die sich hier abzeichnende „Spannung zwischen einer Immanentisierung und einer radikalen Transzendenz“ (64) ist notwendige Bedingung des phänomenalen Feldes, da es bei Zusammenbruch dieser Spannung sofort implodieren würde – diese „Endo-Exogenisierung“ (64) ist für Schnell die basale Leistung der Einbildungskraft. Wie aber leistet das Bild die „Endo-Exogenisierung“ des phänomenalen Feldes? Durch eine „phänomenalisierende“, eine „fixierende“ und eine „generative“ Dimension. Das Bild lässt etwas „erscheinen“; hierzu muss es „die unendliche Beweglichkeit des »Seienden« »diesseits« seiner Phänomenalisierung“ (65) zugunsten einer relativen Stabilität fixieren, wobei es stets Gefahr läuft, lediglich Scheinbilder oder Simulakren zu erzeugen. „Generativ“ ist das Bild nun in diesem Sinne, dass es auf einer „höheren Stufe […] die Beweglichkeit des phänomenalisierten Seienden widerspiegelt“. In dieser „Verdopplung des Bildbewusstseins“ realisiert sich nicht lediglich eine nachträglich gestiftete Einheit von Phänomenalisierung und ontologischer Stabilisierung, sondern die „»reflexible« Dimension der Einbildungskraft“ (66), die den genuin produktiven Charakter des „Bildens“ über alles „Abbilden“ hinaus ausmacht. Auf dieser „ursprünglich konstitutiven Stufe der intentionalen Korrelation“ (67) sind die Fungierungen und Leistungen der Einbildungskraft „ein Grundbestandteil der Konstitution der Realität“ (67). Hierin liegt der Sinn der Rede von der „imaginären Konstitution der Realität“: Deren Pointe ist es gerade nicht, eine diffuse Kontaminierung des Realen durch das Imaginäre zu konstatieren, sondern umgekehrt das Imaginäre als conditio sine qua non der Bestimmbarkeit des Realen als Reales einsichtig zu machen. Selbstverständlich lassen sich eine Faktualität nackter Tatsachen sowie eine irreduzible Ereignishaftigkeit der Welt „registrieren“, und dennoch: „Sobald diese Realität aber auch nur auf ihre geringste Bestimmtheit hin betrachtet wird, kommt die Einbildungskraft ins Spiel“ (68).
Kapitel vier ist der Frage nach einem „phänomenologischen Unbewussten“ gewidmet. Das Unbewusste ist als ein „bildendes Vermögen“ (78) strukturiert. Schnell unterscheidet „drei Fungierungsarten der Einbildungskraft diesseits des immanenten Bewusstseins“ (84): das genetische phänomenologische Unbewusste, das hypostatische phänomenologische Unbewusste, sowie das reflexible phänomenologische Unbewusste. Das genetische phänomenologische Unbewusste bekundet sich dort, „wo die Sphäre einer »immanenten« Gegebenheit überschritten wird“ (74). Der prekäre Status des genetischen phänomenologischen Unbewussten besteht darin, dass sich „der »positive« – im eigentlichen Sinne »genetische« – Gehalt, der hier aufgedeckt wird, auf nichts »Gegebenes« stützen kann“; stattdessen arbeitet sich die Phänomenologie an einer „gewissermaßen »negative[n]« Dimension des phänomenalen Feldes“, also am „Schwanken“ und der „Flüchtigkeit“ diesseits der Stabilität der objektiven Wirklichkeit“ – der „Genesis“ (75) – ab. Das hypostatisch phänomenologische Unbewusste bezeichnet als zweiter Typus des phänomenologischen Unbewussten dagegen den „ersten Stabilisator aller intellektuellen Tätigkeit“ (76). Es gewinnt der „grundlegenden Tendenz“ der Genesis „zur Mobilität, zur Diversität und zum Wechsel“ (75) qua Einbildungskraft eine gewisse „Unbeweglichkeit und Starre“ (76) ab. Während das genetische phänomenologische Unbewusste grundsätzlich „unendlich variabel“ ist, akzentuiert das hypostatische phänomenologische Unbewusste je „denselben Aspekt des Phänomens“ (76). Als wesentlichsten Unterschied zwischen diesen beiden Typen des phänomenologischen Unbewussten veranschlagt Schnell, „dass das hypostatisch phänomenologische Unbewusste sich grundlegend auf die Realität […] bezieht, während das genetische phänomenologische Unbewusste eher zur Aufklärung einer gewissen Erkenntnisweise der Phänomene beiträgt“ (76f.). Dem dritten Typus des phänomenologischen Unbewussten – dem reflexiblen Unbewussten – obliegt darüber hinaus die Aufgabe, das konstituierende „Vermögen des phänomenologischen Diskurses selbst“ (77) einsichtig zu machen. Das „»Gesetz« des »Sichreflektierens« der Reflexion“ (78) entfaltet die Einbildungskraft in „all ihre[r] konstitutive[n] und reflektierende[n] Kraft“ (78) und „begründet“ damit „die »imaginäre Konstitution« der Realität“ (78). Wie verhält sich ein derart bestimmtes Unbewusstes nun zum Selbstbewusstsein? Die These der generativen Phänomenologie lautet, dass „das Selbstbewusstsein im Gegenstandsbewusstsein […] sich nicht reflexiv erklären“ lässt, sondern einen „unmittelbaren Bezug“ voraussetzt, der „eben in den Bereich des Unbewussten“ (79) fällt. Dieser kann „nicht »phänomenologisch konstruiert«“ (80) werden, und unterscheidet sich so von den drei entwickelten Typen des phänomenologischen Unbewussten. Damit positioniert sich die generative Phänomenologie auf einer Linie mit Fichte in klarer Abgrenzung zu „reflexiven Explikationsmodellen des Selbstbewusstseins“ (80). Selbstbewusstsein gründet nicht auf einem Bewusstseinsakt höherer Stufe, der sich von einem erststufigen Bewusstseinsakt numerisch unterscheidet, sondern ist als eine „»präreflexive« Dimension“ (81) in die erststufige, gegenstandsgerichtete Intention „eingebildet“. Der „unbewusste“ Charakter des Selbstbewusstseins besteht demzufolge darin, dass „der Intentionalität (zumindest teilweise) eine Nicht-Intentionalität zugrunde liegt“ (81).
Welchen Beitrag kann ein generativer Ansatz transzendentalen Philosophierens nun zu den gegenwärtigen Kontroversen leisten, die von einem neuerdings erhobenen „realistischen“ Ton in der Philosophie geprägt sind? Ebendiesen legt Kapitel fünf dar. Primäres Ziel ist es, den Standpunkt des Korrelationismus zu präzisieren – „und zwar eben durch das Prisma der Bestimmung der Realität“. Somit gilt es sowohl zu verstehen, was „jedem intentionalen Akt »Realität« zukommen lässt“, als auch „welcher Status der »Realität« dem, was über das Bewusstsein »hinausreicht«, zuzuschreiben ist“ (90). Der Beitrag der generativen Phänomenologie erweist sich als komplexe wie nuancierte Ausarbeitung einer irreduziblen Multidimensionalität des Realitäts-Begriffs. Eines einseitigen Idealismus ist sie dabei deshalb völlig unverdächtig, weil die Grundkategorien der Phänomenalisierung für ihre „realitätsstiftenden Leistungen ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis mit dem Konstituierten“ (108) implizieren. Transzendentale Konstitution kann sich nur als ontologische Fundierung realisieren, welche – einer Art fortwährenden „Epigenese“ nicht unähnlich – die Konstitution selbst kontaminiert. Was die generative Phänomenologie deutlich von gängigen Realismen abhebt, ist die Erarbeitung zahlreicher Aspekte der Nicht-Gegebenheit, die maßgeblich zur Sachhaltigkeit und Intelligibilität des Begriffs der Realität beitragen. Denn „[d]as Reale ist nicht das Gegebene“ (90): Hierfür sprechen die Rolle der Unscheinbarkeit und der Präreflexivität in der Phänomenalisierung, die Präimmanenz als „Milieu“ der Genesis, sowie die reflexive Vernichtung des Bewusstseins in jeder stabilisierten Bestimmung – „das Bewusstsein ist das Vehikel des Gegebenseins, die Realität ist das Zugrundegehen des Bewusstseins“ (91). Den „höchsten Punkt“ der generativen Realitätsproblematik bildet die „Identifikation von Realität und »Reflexion der Reflexion«“ (108), welche die Zusammengehörigkeit des transzendentalen und des ontologischen Status des in der Sinnbildung Eröffneten stiftet. Zu erwähnen ist zudem das den Ausführungen zur „Realität“ angestellte „anankologische Argument“, welches Schnell gegen die Angriffe des „spekulativen Realismus“ auf den „Korrelationismus“ bemüht. Zu Erinnerung: Eine anzestrale Aussage bezieht sich auf einen Sachverhalt, der vor jeglicher tatsächlichen Gegebenheit von Bewusstsein gültig gewesen sein soll, wodurch die angebliche Überflüssigkeit des Korrelationismus aufgezeigt sein soll. Wie aber dem anzestral Bedeuteten die Notwendigkeit objektiver Realität zuweisen? Ohne ein in die Sinnbildung einbehaltenes Bewusstsein kann nicht darüber befunden werden, welche anzestralen Propositionen der Wahrheit entsprechen, und welche nicht – die Möglichkeit, den Sinn einer solchen Proposition zu verstehen, wäre nicht gegeben: „Während beim klassischen ontologischen Argument die Hypothese des Denkens der Wesenheit des Absoluten die Existenz des Absoluten impliziert, schließt hier […] die Existenz der Anzestralität die Notwendigkeit der möglichen Gegebenheit für und durch das sinnbildende Bewusstsein“ (112) ein. Das heißt: Durch die wohlgegründete Behauptung der Anzestralität wird die „Generativität“ des Korrelationismus bewiesen. Dieser pocht im vorliegenden Fall ja gerade nicht auf ein konstituierendes Subjekt, das einem – letztlich nicht intelligiblen – Gegenstand gegenübersteht, sondern ist als jener Sinnbildungsprozess konzipiert, in dessen Genesis sich die notwendige Sachhaltigkeit respektive die Nicht-Halluziniertheit des anzestralen Gegenstandes überhaupt erst herauskristallisieren und stabilisieren konnte.
Kapitel fünf behandelt den Begriff der Wahrheit. Die Phänomenologie fragt nicht primär nach der Wahrheit der „Korrespondenz“ qua logischem oder sinnlichem Zusammenhang zwischen einem Aussagesatz und der ihm entsprechenden Realität, sondern danach, wie sich eine Welteröffnung vollzieht, im Rahmen derer sich etwas als etwas zeigen kann, und damit überhaupt erst „Korrespondenz“-fähig wird. Zentral ist demnach das „konstitutive Verhältnis zwischen der Korrespondenz-Wahrheit und der »ursprünglichen« Wahrheit“ (129). Drei Dimensionen der Wahrheit werden hier relevant: Die „phänomenalisierende Dimension der Wahrheit“ verweist darauf, dass „jegliche[r] »Gegenstand« der Wahrheit“ (129), auf irgendeine Weise zur Darstellung gelangen muss, womit die Entdeckung einer „Sache“ auf eine „konstitutive Weise in ihr Wahrsein“ eintritt. Die „phänomenalisierende Wahrheit“ ist als eine „Manifestierung für… (Erscheinung für…, Gegebenheit für…) einen »Zeugen de jure«“ (130) notwendige, aber keine hinreichende Bedingung jeder Wahrheit. Die zweite Dimension betrifft den „Entzugscharakter der Wahrheit“: In einem transzendentalen Bedingungsverhältnis realisiert sich die Objektivierung eines Bedingten durch den Entzug seines Bedingenden – ein Entzug, der als „negativer Bezug“ in „jede Manifestierung, Erscheinung oder Gegebenheit hineinspielt“ (131). Der Entzug kann sich nun aber als Selbstreflexion dieses „wechselseitigen Bedingungsverhältnisses“ genetisieren, dergestalt, dass er sich als „stetige[r] Wechsel zwischen einer »Präsenz« und einer »Nicht-Präsenz«“ (132) realisiert. Eine solche „Erfahrung“ des Transzendentalen impliziert, „dass das Bedingte auf das Bedingende zurückwirkt“ (131), was eben die Wahrheit „der Erscheinung bzw. der Gegebenheit selbst ausmacht“ (132). Der dritten, der „generativen Dimension der Wahrheit“, obliegt eine doppelte Aufgabe: Sie bestimmt den Entzugscharakter der Wahrheit auf positive Weise und macht verständlich, was genau die Wahrheitsdimension des konstruktiven Vorgehens kennzeichnet. Beides leistet sie als Reflexion der Reflexion: „Die Wahrheit ist die Reflexion der Reflexion […].“ (132) In einem ersten Schritt stellt sie einen Abstand her, in dem sich der Entzugscharakter spiegelt; in einem zweiten Schritt erweist sich die Wahrheit als „produktive Reflexivität“, als eine „erzeugende, schöpferische, d.h. generative Dimension“. Die Wahrheit ist die Dimension, in der sich das Transzendentale als reines Vermögen der Realisierung selbst realisiert: Ein Gegenstand wird reflexiv gesetzt, wodurch dessen Reflexionsgesetz allererst bedingt wird. Nur so entsteht überhaupt ein „Probierstein der Realität“ (133), dergestalt, dass ein Gegenstand nach Maßgabe der präimmanenten Binnendifferenzierung, in welcher sich die Ermöglichung seines So-Seins herausbildet, thematisierbar wird. Denn ein Gegenstand, der eine Aussage wahr macht, ist nicht selbst die Wahrheit; die Wahrheit ist die reflexive Bezugsdimension, eine Art intelligibler Holon, in welchem der Gegenstand als Einheit der Differenz von Reflexion der Reflexion und Realität appräsentierbar ist. Die logische Gestalt, in welcher sich dies zusammen denken lässt, ist die „kategorische Hypothetizität“ (134): Sie bezeichnet den Umschlag einer Möglichkeit in eine Notwendigkeit im Vollzug der Genetisierung einer nicht weiter deskriptiv analysierbaren Gegebenheit qua phänomenologischer Konstruktion – und damit einen Vorschlag zur Lösung der Frage, wie das Notwendige möglich ist. Dass ein solcher „Sprung im Register“ sich in actu realisiert und nicht „untergeschoben“ wird, befreit den generativen Wahrheitsbegriff aus den vitiösen Zirkeln, welche transzendentales und hermeneutisches Philosophieren bis heute prägen.
Das sechste Kapitel unternimmt eine Abhandlung des Problems der Zeit. Wenn die Zeit weder eine subjektive noch eine objektive „Form“, wenn ihre „Vorausgesetztheit“ nicht empirisch-real noch rein logisch ist, sie sowohl in ihrer transzendentalen „Idealität“ wie auch in ihrer empirischen „Realität“ zu denken ist: Wie kann die von Husserl eingeführte, genuin zeitkonstituierende Intentionalität bestimmt werden? „Aktiv-signitiver“ Art kann sie nicht sein, da es sich „um keinerlei bedeutungsstiftende Intentionalität“ (146) handelt; „passiv-intuitiver“ Art kann sie aber auch nicht sein – zwar ist sie sicherlich passiv in dem Sinne, dass sie nicht eigens hervorzubringen ist, aber Anschaulichkeit reicht nicht hin, um ihre präintentionale Konstitution verständlich zu machen. Es gilt also, qua phänomenologischer Konstruktion eine Form der Selbstgegebenheit aufzuzeigen, die weder „auf ein rein passives Vorliegen, noch auf eine Einbettung der Spontaneität in eine [bereits objektiv konstituierte, F.E.] zeitlich-sinnliche Dimension verweist“ (150). Hierzu unterscheidet Schnell zuerst zwei Arten der immanenten Zeitlichkeit, „erlebte Zeit“ und „gestiftete Zeit“: Die erlebte Zeit umfasst das volle Spektrum der Möglichkeiten von Erscheinungsweisen der Zeit – jedes Seiende hat seine ihm „ureigene Zeit“ (148). Spezifisch für die erlebte Zeit ist ihre enge Verflochtenheit mit der Erfahrung eines „Ich“: Sie erzeugt stets nicht-anonyme „Weisen der Horizonteröffnung, die zuallererst für uns selbst die Welt offenbar zu machen gestatten“. Des Weiteren zeichnet sie sich durch „radikale Reflexionslosigkeit“ (148) aus. Die gestiftete Zeit hingegen zielt auf Einheitlichkeit, auf einen Maßstab, der zur „Zeitmessung“ dienen kann. Dabei kommt es zu einem „Gegensatz zwischen der Vielfalt der Zeiten […] und der Einheit der gestifteten Zeit“ (149), sowie zu einer Aporie der Reflexion: Innerhalb der gestifteten Zeit wird ein absoluter Zeitrahmen vorausgesetzt, der „präempirisch und präreflexiv“ ist; die Einheitlichkeit ist aber ein Produkt der Reflexion. Die Reflexion ist demnach nicht das geeignete Mittel, „um die Konstitution der Zeit und des Zeitbewusstseins verständlich zu machen und zu rechtfertigen“ (149). Wie ist es also möglich, dem „Zeitcharakter der erlebten Zeit einerseits und der gestifteten Zeit andererseits phänomenologisch-konstruktiv […] auf die Spur zu kommen“ (150)? Dargelegt werden muss, wie die Vermittlung von „Protentionalität“ und „Retentionalität“ zu plausibilisieren ist, ohne das Schema Auffassung/Auffassungsinhalt auf eine „rein hyletische Urimpression“ anzuwenden. Hier kommt eine dritte Art der Zeitlichkeit zum Tragen, die „präimmanente Zeit“. Diese stellt sich dar als ein die immanenten Zeitlichkeiten konstituierendes Phasenkontinuum, der „Urprozess“. Jede Phase dieses Kontinuums ist ein „»retentionales« und »protentionales« Ganzes“ (151), und besteht aus einem „Kern“ – auch als „Urphase“ bezeichnet – maximaler Erfüllung, sowie aus modifizierten Kernen, deren Erfüllung proportional zur Entfernung von der Urphase nach Null hin tendiert. Dergestalt eröffnet sich ein Feld von „Kernen“, die „im Ablauf ihrer Erfüllungen und Entleerungen eben die präimmanente Zeitlichkeit ausmachen“ (152), und als „Substrate“ der Noesis die Intentionalität strukturell konstituieren. Das „Selbsterscheinen“ (153) dieses Urprozesses am Schnittpunkt der jeweils diskreten „Kerne“ ermöglicht ineins die ursprüngliche Gegenwart des präreflexiven Selbstbewusstseins wie auch jede gestiftete und erlebte Zeit.
Die räumlichen Aspekte der generativen Phänomenologie sind Gegenstand des siebten Kapitels. Ziel ist es, die Konstitution der Räumlichkeit und des Räumlichkeitsbewusstseins zu erhellen. Grundlegende Beiträge liefern Husserl mit der Darstellung der Relevanz von „Leiblichkeit“ und „Einbildungskraft“ bei der Konstitution des Raumes, sowie Heidegger durch die Vorarbeiten zum Begriff einer Endo-Exogenisierung des phänomenologischen Feldes. Maßgeblich für den Ansatz der „Wirklichkeitsbilder“ sind jedoch die Analysen, die Marc Richir hinsichtlich der räumlichen Aspekte der Sinnbildung vorgelegt hat. Leitend sind dabei zwei Fragestellungen: Was ist die leibliche Dimension der Sinnbildung? Was sichert und ermöglicht den Bezug auf eine Äußerlichkeit, die es vermeidet, diese Sinnbildung durch ihre Immanentisierung in eine Tautologie verfallen zu lassen? An diese Perspektive anschließend sucht Schnell „Räumlichkeit“ als eine „grundlegende Dimension des Sinnbildungsprozesses“ (171) in den Blick zu bekommen. Hierzu wird eine dreifache Differenz angesetzt: Die räumliche Bestimmtheit der „scheinbaren Exogenität“ in natürlicher Einstellung – also die Erfahrung einer „Äußerlichkeit“, die als „präexistent“ oder „prästabilisiert“ angesehen wird –, verwischt die Notwendigkeit, diesseits der Unterscheidung von „Innen“ und „Außen“ ein diese Unterscheidung erst ermöglichendes „Vermittlungsverhältnis von Endogenität und Exogenität des phänomenologischen Feldes“ (172) zu konzipieren. Die „räumliche Dimension der Hypostase“ thematisiert den Umstand, dass trotz der Zusammengehörigkeit von Räumlichkeit und Zeitlichkeit als „Raumzeitlichkeit“ – der „Grundform der Phänomenalisierung“ (173) –, spezifische Unterschiede zwischen räumlichen und zeitlichen Bestimmungen bestehen. Während die Zeit grundlegend durch ein Fließen charakterisiert ist, erscheint der Raum hingegen „fix, stabil, unwandelbar“. „Hypostase“ als „transzendentaler Ausdruck“ dieser Stabilität ist qua phänomenologischer Konstruktion zweiter Gattung als produktive Vernichtung der Bewegung zu fassen, dahingehend, „dass hierdurch sowohl die räumliche Dimension des Verstehens als auch das, worin das Verstehen sich entfaltet, gedacht zu werden vermag“ (174). Als dritte räumliche Bestimmtheit werden die „räumlichen Implikationen der transzendierenden Reflexibilität“ entfaltet. Während die „transzendentale Reflexibilität“ als die Eigenschaft der Sinnbildung ausgemacht wurde, welche die „innerlichen Notwendigkeiten“ des phänomenalen Feldes aufdeckt, kommt es hier darauf an, die „transzendierende Reflexibilität“ als die Eigenschaft der Sinnbildung zu begreifen, welche die „äußerlichen Notwendigkeiten“ des phänomenalen Feldes zu erschließen gestattet. Ausschlaggebend ist dabei, dass diese nicht lediglich auf etwas Vorgängiges reflektiert, sondern „das Sich-erscheinen des (Sich-)reflektierens erfasst wird“. Ermöglicht ist dies durch eine „Identifikation zwischen dem Abstand von Alterität und Äußerlichkeit“ (175), sowie ein dem Sinnbildungs-Schematismus innewohnender Abstand zu sich selbst; beide Aspekte fungieren als basaler Bezugsrahmen jeder weiteren räumlichen Bestimmbarkeit.
Das achte Kapitel wendet sich der Konzeption einer neuen phänomenologischen Anthropologie zu, in deren Zentrum der Begriff des „homo imaginans“ steht. Bei der generativen Konturierung des Humanum steht nicht das Verhältnis von Anthropologie und Phänomenologie im Mittelpunkt, sondern diejenigen Bestimmungen, welches es ermöglichen, den „Status des Menschen diesseits der Unterscheidung von Erkenntnistheorie und Ontologie“ (187) offen zu legen. Jeder Bestimmung gehen genetisch-imaginative Prozesse voraus, welche die Intelligibilität einer möglichen Bestimmung erst gewährleisten. Um einer „vorausgesetzten Welt“ anzugehören, muss der Mensch immer schon dreifach „bildend“ tätig gewesen sein: qua Vorstellung, qua Reflexion, und qua Einbildung. Die „Vorstellung“ ist das Phänomen, „durch das wir uns ursprünglich auf die Welt beziehen“ (188). Sie lässt erscheinen, nach Maßgabe implizierter Verständnisse von „Welt“ und „Selbst“. In der „Reflexion“ wird das Bild als Bild thematisch, gerät in einen Abstand zu sich: Die Welt geht in ihrem Bild nicht auf. In der Vernichtung der „Kompaktheit und Geschlossenheit“ (191) des ersten Bildes wird das ihm implizite „Selbst“ als entwerfendes explizit; die im ersten Bild prätendierte Stabilität der Welt wird in eine irreduzible Abständigkeit von Bild und Welt transponiert, die selbstverständliche Unmittelbarkeit des Bildes wandelt sich in das reflexive Bewusstsein, durch ein Selbst geleistet worden zu sein – an die Stelle eines Bildes der Welt tritt ein Bild des Selbst. Der spezifisch menschliche – nicht mechanische! – Charakter der Reflexion wird aber erst mit der „Einbildung“ erfasst: Jedes Bewusstsein von etwas ist nicht nur „vorstellendes“ und „reflexives“ Bewusstsein, sondern auch „reflexibles“ Bewusstsein. Das, was es möglich macht, verdoppelt sich in „das, was das Möglich-Machen selbst möglich macht“ (192) – die „bedingende“ Möglichkeit erscheint selbst in ihrem Vermögen, das, was möglich macht, ihrerseits möglich zu machen. Anders formuliert: Das Sein-Können der Bild-Bildung erscheint in den zu diesem Können notwendigen Bedingungen. In der Reflexion auf die Reflexion der Vorstellung realisiert sich die transzendentale Struktur des Bewusstseins als die Ermöglichung ihrer selbst – diese „ist“ nur, insofern sie sich „bildet“. Nachdem die generative Verfahrensweise ihre Rechtmäßigkeit durch die Wohlgegründetheit – ohne „negativen“ Zirkel – ihrer Möglichkeit erwiesen hat, kommt als ihr Korrelat nur das Reale selbst in Frage. Die ontologischen Implikationen dieses Realen sind eben jene Bedingungen, die zur Realisierung des „ermöglichenden Vermögens“ (193) zu veranschlagen sind. Der Mensch ist „homo imaginans“ bedeutet dann: Jedes Bewusstsein, das sich als Einheit der Differenz von Selbstentwurf, Reflexivität und Reflexibilität selbst erscheint, ist humanes Bewusstsein.
Das letzte Kapitel dient einer Synopse der Grundlegung eines spekulativen Transzendentalismus in der Gestalt einer generativen Phänomenologie. Schnell hebt als Leitmotiv die „Endoexogenisierung des phänomenalen Feldes“ als neue, „auf die Transzendenz hinausweisende“ Dimension der Subjektivität hervor, die „den konstitutiven Vorrang der Einbildungskraft“ (195) als „Matrize der Subjektivität“ (198) sichtbar werden lässt. Die Pointe ist dabei, dass „die Transzendenz nicht bloß das »formale Andere« des konstitutiven Vermögens“ der Subjektivität ist, sondern diese „gleichsam selbst konstituiert“ (198). Vier Spielarten der Transzendenz bilden dabei den Möglichkeitsraum der Phänomenalisierung des Subjekts im Prozess der Sinnbildung: „Prinzip oder absolutes Ich“, „Welt“, „Radikale Alterität“, „Absolute Transzendenz“. Durch die Aufweisung eines „phänomenalisierenden“ Moments, eines „plastischen-vernichtenden und zugleich hypostatischen“ – und dank dieses Zusammenwirkens „reflexiven“ – Moments, sowie eines „reflexiblen“ Moments bekundet sich die Einbildungskraft als „ursprünglich bildendes Vermögen“ in phänomenologischen Konstruktionen, wobei keine epistemische oder ontologische Priorität eines dieser Momente festzustellen ist. Die qua phänomenologischer Konstruktion anvisierten „transzendentalen Erfahrungen“ konkretisieren sich in Auseinandersetzung mit jeweiligen „phänomenalen Gehalten“. Sie „gelingen“ als „Fundierung ohne Fundament“ (209), wenn die Genesis der Faktualität vollzogen werden kann, und die „Möglichkeit der Notwendigkeit“ am Zu-Genetisierenden verständlich wird.
Liest man die „Wirklichkeitsbilder“ im Kontext seiner bisherigen – mehrheitlich französischsprachigen – Forschungen, wird einsichtig, auf welchem Reflexionsniveau Schnell den transzendentalen Problemhorizont entwickelt. Verglichen mit dem Stand aktueller Literatur zum Thema ist der hier zum Einsatz kommende Begriff des Transzendentalen in seiner systematischen Prägnanz und historischen Tiefe beispiellos: Die von Kant angestrebte Erkenntnislegitimation wird unternommen, der spekulativ-imaginative Ansatz Fichtes in die Auseinandersetzung mit konkreten phänomenalen Gehalten gebracht, der von Schelling beschriebene Prozess der Selbst-Objektivierung der Natur in seinen architektonischen Implikationen als wechselseitiges Bedingungsverhältnis entfaltet, Husserls Überforderung der Anschauung in transzendentaler Perspektive mithilfe neu entwickelter Kriterien phänomenologischer Ausweisbarkeit zur Disposition gestellt, und schließlich Heideggers Figur der „Ermöglichung“ ausgestaltet. Die transzendentalphilosophische Gretchen-Frage, wie das Apriori selbst begründet werden kann, ist pointiert entwickelt und aufschlussreich beantwortet; die generative Plausibilisierung der Möglichkeit, wie durch apriorische Denkformen das Seiende in seiner Realität erfasst werden kann, ist erstrangig unter den bisherigen Versuchen der phänomenologisch-transzendentalen Tradition. Gerade für Skeptiker eines transzendentalen Philosophie-Stils wird es überraschend ein, dass der Begriff der Realität letztlich nur „gewinnt“: Keine einzige empirisch-inhaltliche Bestimmung des Realen wird in ihrer Gültigkeit desavouiert, sondern lediglich in einen Bezugsrahmen transponiert, der die Möglichkeit ihrer Wohlgegründetheit verständlich macht. Der vor allem gegen Fichte oft vorgebrachte Einwand, weshalb der Realismus erst auf einer „Meta-Stufe“ einsetzen sollte, verliert durch die Herausstellung der Einheit des transzendentalen und ontologischen Status des in der präimmanenten Sphäre Eröffneten an Wucht. Diese Einheit ist dabei keine De-Realisierung „objektiver“ Sachhaltigkeit, sondern eröffnet die Möglichkeit, eine Zusammengehörigkeit von Realitätsbestimmung und Erkenntnislegitimation so zu denken, dass einsehbar wird, wie Aussagen überhaupt Gegenstände „treffen“ können. So verwandelt sich der „Korrelationismus“ am Leitfaden seiner „Endo-Exogenisierung“ in eine philosophische Position mit einer Leistungsfähigkeit, sowohl der „Immanenz“ als auch der „Transzendenz“ Rechnung zu tragen, die ihm in diesem Ausmaß wohl selbst von seinen Verfechtern kaum mehr zugetraut wurde. Es bleibt abzuwarten, ob sich Realismen, die eine robuste Schlichtheit und Selbstverständlichkeit des Sich-Beziehen-Könnens auf Reales als besonders „realistisch“ inszenieren, sich der in der generativen Phänomenologie erschlossenen Komplexität des Zustandekommens eines nicht-trivialen, sachhaltig bestimmbaren Realitäts-Begriffs stellen. Geschieht dies nicht, befänden wir uns in einer für jeden „Realismus“ wenig schmeichelhaften ideengeschichtlichen Lage, in der ein phänomenologisch fundierter, aber nichtsdestotrotz spekulativer Transzendentalismus zum begrifflichen Kern seiner ureigenen Ambition wesentlich mehr beizutragen hätte als er selbst.
Auch das phänomenologische Pensum der „Wirklichkeitsbilder“ ist beachtlich. Schnell beherrscht die klassische Phänomenologie (Husserl, Heidegger, Fink) ebenso differenziert wie die französische Phänomenologie (vor allem Levinas und Richir). Besonders hervorzuheben ist dabei sein elaborierter Umgang mit zentralen Aspekten des Werks des hierzulande noch kaum erschlossenen belgischen Phänomenologen Marc Richir, dem der so zentrale Begriff eines Sich-bildenden-Sinns (sens se faisant) entlehnt ist. Und unabhängig davon, ob die konkrete methodische Verfahrensweise der phänomenologischen Konstruktion anerkannt und praktiziert wird, ist die Trias der Tatsachen, welche die generative Phänomenologie ausweist, unter allen Umständen ein bleibender Ertrag: An der Unterscheidung zwischen „Urtatsachen“ als Thema phänomenologischer Metaphysik, „Gegebenheits-Tatsachen“ plus präreflexiver Implikationen als Thema deskriptiver Phänomenologie und „präintentionalen Tatsachen“ als Thema konstruktiver Phänomenologie dürfte für jede zukünftige Phänomenologie kein Weg vorbei führen. Besonders verdient macht sich die generative Phänomenologie zudem um den Begriff der Intentionalität: Dieser droht zu Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend zu einem metaphysischen Ausgangspunkt der philosophischen Theorie-Bildung zu gerinnen, dessen weiterer Erklärung es nicht mehr bedarf. Ein avancierter Bild-Begriff scheint dabei eine viel versprechende Herangehensweise, das Projekt einer „systematischen Enthüllung der konstituierenden Intentionalität selbst“ (Hua I, 164) als unabdingbare Aufgabe des Phänomenologisierens weiterhin ernst zu nehmen. In den „Wirklichkeitsbildern“ zeichnet sich ab, dass er durchaus über das nötige Potenzial verfügt, das oft übergangene, aber grundlegende Problem der Motivation und Begründetheit der „Leerintentionalität“ als pronominalem Bezug auf ein ens intentum tantum – ein „Alles“ ohne definierte Grenze – neu und äußerst erhellend aufzuwerfen. Hier könnte die generative Phänomenologie wichtige Fragen klären, die auch in der Sinnfeldontologie von Markus Gabriel aufkommen – Fragen, die allesamt um das Sein des Sinns kreisen –, dort aber bisher einer überzeugenden Lösung harren.
Wie es seitens des Phänomenologinnen allerdings aufgenommen werden wird, dass Schnell nicht das Transzendentale zugunsten des „Prinzips aller Prinzipien“ kippt, sondern umgekehrt dem „Prinzip aller Prinzipien“ zugunsten des Transzendentalen als methodologischer Grundlage eine dezidierte Absage erteilt, bleibt abzuwarten. Hier bedarf es wahrscheinlich noch weiterer Klärungs- und Darstellungsarbeit, um die spezifische Intuitivität der phänomenologischen Konstruktionen auch für SkeptikerInnen der Möglichkeit einer Imaginations-basierten „Fundierung ohne Fundament“ zu erschließen. Denn auch die „Wirklichkeitsbilder“ sind kraft ihres methodischen Anspruchs von dem mitunter quasi-weltanschaulich geführten Disput betroffen, ob es eine genuine phänomenologische Methodologie überhaupt gibt. Jedoch ist das Reflexionsniveau und das Rezeptionsspektrum der generativen Phänomenologie wesentlich höher zu veranschlagen als das von populären Bestreitungen der Möglichkeit phänomenologischer Methodologie, wie sie beispielsweise Tom Sparrow mit „The End of Phenomenology“ vorgelegt hat. In diesem Text werden weder die systematischen Verbindungslinien zwischen Phänomenologie und Transzendentalphilosophie noch die neuesten Entwicklungen der phänomenologischen Theorie-Bildung berücksichtigt, was die Ergebnisse entweder zur Glaubensfrage oder obsolet macht – eine Alternative, die doch gerade der Phänomenologie vorgeworfen wird. Die Herausforderung bleibt dennoch bestehen: Jede Phänomenologie, so binnendifferenziert sie auch sein mag, muss sich zusätzlich an der Möglichkeit messen lassen, ob sie über den Kreis derer, die sich schon für sie als Philosophie-Stil der Wahl entschieden haben, auf eine Weise rezipierbar ist, die ihr ein nachhaltiges Sich-Einschreiben in einen globalen Austausch des Philosophierens erlaubt. Dies kann und muss sie einerseits durch die Sachhaltigkeit ihrer Darstellungen, aber auch durch die Ernstnahme der zeitgenössischen hermeneutischen Situation leisten, die nach wie vor durch naturalistische und wieder durch metaphysische Grund-Orientierungen geprägt ist. Für einen Text mit methodologischem Anspruch wie die „Wirklichkeitsbilder“ könnte dies beispielsweise bedeuten, den Begriff der phänomenologischen Konstruktion und den Begriff der Abduktion als methodische Optionen mit jeweiligen epistemologischen und ontologischen Implikationen explizit zueinander in Beziehung zu setzen, um Ausgangspunkte für Diskussionen zu erzeugen, die Stil-unabhängig geführt werden können.
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass sich der vorliegende Ansatz als äußerst wertvoll zur Re-Vitalisierung einer phänomenologischen Psychopathologie erweisen könnten. Einiges deutet darauf hin, dass die sich dort artikulierenden Blockierungen des Selbst- und Welt-Vollzugs stärker als bisher herausgestellt imaginativer Natur sind. In vielen pathologisch relevanten Fällen ist eine „Monotonie des Bildbildungsschemas“ (Blankenburg) auffällig, die bisher nicht systematisch als spezifische Modifikationen der Einbildungskraft identifizierbar werden, welche in einer ko-generativen Beziehung zum leichter ausweisbaren, veränderten Reflexions- und Affekt-Erleben stehen. Hier drängt sich die Frage auf, ob nicht „diesseits“ aller gängigen Unterscheidungen – Verstand / Gefühl / Leib / Gemeinschaft / Welt – bisher nicht explizit thematisierbare Weisen der Wieder-Intensivierung der imaginativen Ressourcen in den Blick kommen könnten. Dies wäre jedenfalls ab dem Moment möglich und sinnvoll, in dem die imaginäre Konstitution der Wirklichkeit auf grundbegrifflicher Ebene hinreichend plausibilisiert und ausgearbeitet wäre – hierzu sind die „Wirklichkeitsbilder“ ein gewaltiger und verdienstvoller Schritt.
 Heidegger unter Bildhauern. Körper, Raum und die Kunst des Wohnens
Heidegger unter Bildhauern. Körper, Raum und die Kunst des Wohnens