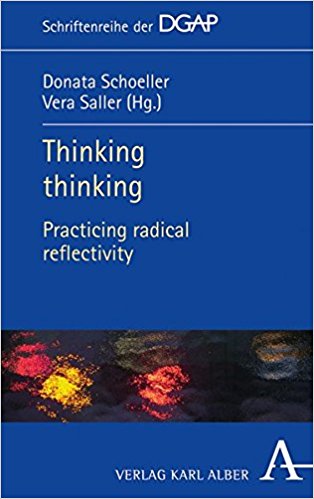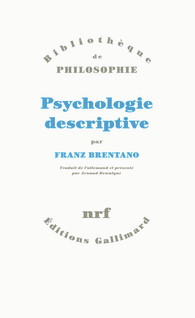Der Andere in der Geschichte - Sozialphilosophie im Zeichen des Krieges. Ein kooperativer Kommentar zu Emmanuel Levinas' "Totalität und Unendlichkeit"
Der Andere in der Geschichte - Sozialphilosophie im Zeichen des Krieges. Ein kooperativer Kommentar zu Emmanuel Levinas' "Totalität und Unendlichkeit"
Verlag Karl Alber
2016
Paperback 40,00 €
432
Reviewed by: Anne Clausen (University of Göttingen)
Das 1961 erschienene erste Hauptwerk von Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’exteritorité, hat auch im Jahre 2017 nichts von seiner Aktualität verloren. Die darin behandelte Frage nach der Andersheit und dem Anspruch des (ganz) Anderen behält angesichts von Flüchtlingskrise, Terrorismus und kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Teilen der Welt seine thematische Relevanz, die zu dem Denken über Gerechtigkeit, Ethik und Ansprüche wie es etwa im Kontext von Habermas oder Rawls geschieht, eine ernst zu nehmende Infragestellung und Alternative darstellt.
Lévinas steht für ein Denken von Alterität oder Ander(s)heit, die sich jeder Verfügung entzieht und nur als Überschuss verstanden werden kann, der zugleich das Subjekt in seiner oder vielmehr als Verantwortung für den Anderen konstituiert. Er eröffnet damit den Blick für einen Bezug auf den Anderen, in dem wir schon stehen, bevor wir Verträge schließen und Politik treiben. So bringt er zur Sprache, was „‚zwischen uns’ geschieht, bevor es überhaupt zu normativen Fragen des Guten und des Gerechten kommen kann“ (Liebsch, 23). Der Andere begegnet dem Ich als Gesicht bzw. Antlitz und das Einzige, was positiv über ihn gesagt werden kann, ist gerade, dass er konstitutiv nicht in dem Eigenen aufgeht. Diese Fremdheit des Anderen macht zugleich seine Freiheit aus, die zu schützen die unbedingte Forderung ist, die an das Ich ergeht.
Die radikale Unverfügbarkeit des Anderen sprachlich zu fassen stellt ein Paradox dar, das Lévinas zu immer neuen Formulierungen an der Grenze der Sprache treibt. Dabei geht es darum, ein Jenseits des Seins zu denken bzw. den Anderen anders zu denken denn als „Teil einer als ‚Schauspiel’ aufgefassten Welt oder als ‚Theater’ eingestuften Weltgeschichte“ (vgl. Liebsch 46). Die Geschichte ist nicht das „Maß aller Dinge“ (Vgl. Lévinas, Schwierige Freiheit 151), sondern kann und muss von der Beziehung Von-Angesicht-zu-Angesicht her korrigiert werden (vgl. Liebsch 11), die sich der Totalität entzieht. Notorisch problematisch bleibt dabei die Frage, wie radikale Geschichtskritik und anti-historisches Denken der Alterität doch wieder mit der Geschichte und vor allem mit dem Politischen zusammenzubringen sind. Es resultiert das dringende „Desiderat, in diesem alteritätstheoretisch anspruchsvollen Sinne ethisches und historisches Denken zusammenzubringen“ (Liebsch 14).
Diesem Desiderat nähert sich Burkhard Liebsch an und fügt mit seinem 2016 im Karl Alber Verlag erschienenen kooperativen Kommentar der breiten Literatur einen neuen und informativen Beitrag hinzu, dessen Alleinstellungsmerkmal darin besteht, sich dem vieldiskutierten Werk in Einzelanalysen zu widmen, die sich chronologisch den einzelnen Abschnitten des Werkes widmen. Der 400 Seiten starke Kommentar ist dafür in 16 Einzelanalysen plus Einführung und Nachtrag des Herausgebers organisiert, in denen bekannte Namen der Lévinas-Forschung jeweils einen kurzen Abschnitt des Werkes behandeln. Anstelle einer akribischen Interpretation bemühen sich die einzelnen Autoren und Autorinnen dabei, die Thematik des jeweils behandelten Abschnittes in einen größeren Kontext zu fassen und auf je eigene Weise zu fokussieren. Die einzelnen Analysen unterscheiden sich dabei erheblich darin, ob sie sich ganz auf den Ausschnitt beschränken oder diesen eher zum Anhaltspunkt für weiterführende Überlegungen nehmen. So entsteht ein sehr reichhaltiger Überblick mit detaillierten Einzelinterpretationen, der zudem – nicht zuletzt dem Schreiben von Lévinas selbst geschuldet – mit der Polyphonie der Stimmen ein Sagen und Wieder- bzw. Wider-Sagen der zentralen Motive beinhaltet. Die großen Themen wie der Genuss und die Sinnlichkeit des Subjekts, ein anderes Denken der Intentionalität, die Vorgängigkeit des Anderen und die Verantwortung für ihn, Ontologiekritik und das Jenseits des Seins und natürlich das Gesicht bzw. Antlitz werden so immer noch einmal neu perspektiviert. Im Gespräch mit Kant, Hegel, Heidegger, Sartre, Derrida, aber auch Proust und Beckett werden einzelne Diskursstränge herausgeschält, gesagt und wi(e)der gesagt. Neben der vorwiegend affirmierenden Lektüre richten sich dabei auch einige kritische Fragen an den Autor, die insbesondere die Implikationen des Alteritätsdenkens und die philosophische Haltbarkeit der vorgebrachten Thesen betreffen. So entsteht ein lebendiges, reiches und auch spannungsvolles Bild des Werkes, das zeigt, dass die Auseinandersetzung mit Lévinas auch nach mehr als 55 Jahren nicht abgeschlossen ist.
Zum Auftakt thematisiert Hans-Christoph Askani die Beziehung zum ganz Anderen, die das Ich sich selbst entreißt und die Lévinas als Metaphysik bezeichnet . Er zeigt, dass der hiermit angezeigte Bruch mit der Totalität sich in der Sprache und als metaphysisches Begehren ereignet, das dem (weltlichen, leiblichen) Bedürfnis entgegensteht. Dieser Bruch wird als Bedingung der Möglichkeit von Frieden ausgewiesen; es gibt aus der Totalität und d.h. vom Krieg „einen Ausgang, weil es in sie einen Einbruch gibt.“ (87)
Der Herausgeber selbst, Burkhard Liebsch, nimmt sich Lévinas’ „sozialphilosophisch gewendet[e]“ (89) Lesart von Descartes vor, mit der dieser zu zeigen versucht, dass das Soziale, verstanden als Begegnung mit dem ganz Anderen, das Epistemische fundiert (vgl. 90f.). Diese Begegnung ist, so Lévinas, nur möglich in einem getrennten Psychischen, das sich der „Aufhebung in Geschichte“ (95) widersetzt. Das Begehren des Anderen bewirkt dann eine Umkehrung oder „Konversion“ des Seienden, in der es sein Glück, seinen Genuss, für den Anderen aufzugeben bereit ist. Liebsch stellt jedoch die beschriebene Selbstgenügsamkeit dieses Subjekts der Trennung in Frage – „Können wir wirklich in psychischem Leben derart bei uns selbst ‚zuhause’ sein […] ?“ (110) – die zudem in Spannung mit Lévinas’ späteren Andeutungen steht, denen zufolge das Subjekt immer schon ein Empfangenes, d.h. dem Anderen schon begegnet sei.
Bernhard H.F. Taureck gibt den wohl am wenigsten favorablen Ausblick auf Lévinas. Seine Analyse der Freiheit stellt „kritisch-polemische“ und „eklektische“ „Evidenzen“ heraus, die nur durch die weitere „Evidenz“ der „Verklärung“ eine gewisse Attraktivität erhalten, und sieht Lévinas letztlich in einer Komplementärstellung zu Beckett: „Wenn Levinas die Verwüstung verklärt, so wird hier die Verklärung verwüstet. […] Was der eine befestigt, reißt der andere ein und umgekehrt.“ (134f.)
Auf den dann folgenden Seiten stellt Sophie Loidolt die „Intentionalität des Genießens als Grundstruktur der Subjektivität“ (136) heraus, die sowohl zu der Intentionalität Husserls als auch zu der Sorgestruktur des Daseins bei Heidegger eine Alternative darstellt. Als „leben von…“ hat Existenz eine irreduzibel sinnliche Qualität, die es nur gestattet, eine Unabhängigkeit des Subjekts in der Abhängigkeit von etwas zu denken, die die Voraussetzung für die Begegnung mit dem Andern ist. In dieser Darstellung fährt Alwin Letzkus fort, der den Genuss als „die eigentliche, weil tiefste Wurzel der Intentionalität“ (161) herausstellt: Die Vorstellungen des Bewusstseins selbst sind vom Genuss getragen. Nur diese Konzeption eines nicht auf Intentionalität und Repräsentation reduzierten Bewusstseins soll es erlauben, die Transzendenz des Anderen zu denken.
Pascal Delhom arbeitet die „Struktur der bedingten Bedingung“ (186) heraus, die sich zuerst in der doppelten Vorgängigkeit von Gegenständen und Ich zeigt (176f.) und sich bezüglich der Begegnung mit dem Anderen wiederholt: Einerseits setzt diese die Trennung des Individuums voraus, andererseits ist diese Trennung aber nur möglich, weil das Subjekt dem Anderen bereits begegnet ist, d.h. von ihm empfangen wurde. Delhom sieht hier „jenseits aller Dialektik“ eine spezifische Verbindung von Aktivität und Passivität beschrieben, die die Setzung eines Ichs ermöglicht, das der Offenbarung des Anderen fähig ist (vgl. 187).
Auch Gabriella Baptist stellt die Vorgängigkeit der Begegnung mit dem Anderen heraus, durch die eine „Dimension der Aufmerksamkeit eröffnet [wird], die sich vom Genuss der Elemente und von den Bedürfnissen des Lebens und deren Nahrung befreien kann“ (192) und die letztlich auch die Enteignung durch den Anderen, nämlich das Geben, erlaubt. Die Autorin kontrastiert Lévinas’ Darstellung der Bleibe mit dem In-der-Welt-sein bei Heidegger, dem sich auch Antje Kapust noch einmal als der Bedingung und dem Anfange menschlicher Bezugnahme zur Welt widmet (vgl. 203).
Matthias Flatscher und Sergej Seitz gehen auf die Rolle der Sprache ein, die bei Lévinas „nicht in epistemologischer Hinsicht betrachtet, […] sondern als ein responsives Geschehen gefasst [wird]“ (220) und Transzendenz ermöglicht (vgl. 223). Der Andere sei kein Inhalt, der sich thematisieren ließe, sondern er wird angesprochen und drückt sich aus; ihm gegenüber steht das Ich in der Verantwortung, die es erst konstituiert. Gegen die Selbstkritik von Lévinas an seinem eigenen Werk schlagen die Autoren vor, „eines der produktivsten Momente von Totalität und Unendlichkeit [] [in dem] Anbieten eines alteritätsaffinen Seinsbegriffs [zu] verorten“ (234).
Der Frage, wie etwas zugleich Modalität des Bewusstseins und Exteriorität sein kann, widmet sich Alain David. Um diese paradoxe Qualität des Gesichts zu denken, muss – gegen Husserl und Heidegger – eine Sinnlichkeit gedacht werden, die die Intentionalität des Bewusstseins überschreitet und bei der es nicht um „die Offenbarung der Welt, sondern [um] diejenige der Sprache – als Sprache des Anderen“ (255) geht.
In einem stärker systematisch orientierten Zugang beleuchtet Werner Stegmaier die Destruktionen, die Lévinas vornimmt, indem er den Blick für die ethische Beziehung zum Anderen öffnet: An die Stelle des Spekulativen, des Prinzipiellen, des Theoretischen und des Definitiven rückt das Über-sich-hinaus-gezogen-werden des Denkens, die ethische Beziehung, die Umorientierung im Denken des Denkens, der Sprache und der Gesellschaft. Der Beitrag von Hans-Martin Schönherr-Mann hat eine ähnliche Stoßrichtung, indem er den Institutionen, dem Werk und der Geschichte, in denen das Individuum nicht als solches erhalten bleibt, den Pluralismus entgegensetzt, der sich in der Beziehung zum Anderen ereignet und durch die Geduld, die Epiphanie des Antlitzes und die Verantwortung expliziert wird. Wie der Autor zeigt, ermöglichen es diese Figuren, eine Subjektivität zu denken, die sich von sich selbst entfernt, ohne dass dies als Unterwerfung unter das Universelle zu denken wäre.
Vor dem Hintergrund eines Überblicks über die großen Themen, die in Totalität und Unendlichkeit verhandelt werden, – die Priorität der Alterität vor der Identität, die (Inter-)Personalität und Pluralität vor Universalität und Rationalität und die Individualität und Responsivität vor der Intentionalität und Totalität – gibt Christian Rößner ein Bild jener „Phänomenologie des Eros“ (313, nach einer Überschrift in Jenseits des Seins), wo die „Zweisamkeit zu keiner erotisch-platonischen Einheit“ (316) verschmilzt. Dabei stellt er heraus, dass dieser Teil des Buches, der vor allem feministische Kritiken auf sich gezogen hat, seine literarische Vorlage in Prousts Albertine hat. Christina Schües stellt die Fruchtbarkeit, die Lévinas im letzten Teil seines Werkes behandelt, als eine Möglichkeit heraus, Transzendenz zu denken, indem sich das Subjekt hier nicht „mitnimmt“ und damit die Einheit der Selbigkeit aufgebrochen wird. Der Sohn bedeute die Befreiung des Vaters und erlaube es, eine unendliche und diskontinuierliche Zeit zu denken, in der Vergebung möglich sei.
Dieter Mersch stellt im Sinne der „Konversion des Bezugs“ (351), die die Destituierung der Ontologie, die Priorisierung der Passivität vor der Aktivität und eine Ethik der Alterität beinhaltet, das „Von-Angesicht-zu-Angesicht“ als Quelle des Sozialen heraus, das einerseits dieses Soziale anders verstehen lässt – nämlich nicht als Gefüge von „‚Interaktion’ bzw. den Regeln interpersonaler Verständigung“ (359) – und andererseits eine „Ethik ohne Gesetz“ (369) begründet.
Und schließlich differenziert Alfred Hirsch zwei Stufen der Freiheit: zuerst jene willkürliche und einsame Freiheit des genießenden Subjekts und dann die moralische Freiheit, in die das Ich durch den Anderen eingesetzt wird. Hirsch sieht durch den Eintritt des Dritten die „Möglichkeit der Symmetrie, des Austausches und die Gerechtigkeit“ (386) gegeben, wobei es der „Asymmetrie des ethischen Anspruches durch den Anderen “ bedarf, die „verhindert, dass der Staat nicht zum Unrechtsstaat mit gutem Gewissen wird.“ (387)
Hiermit kehrt das Buch letztlich zu der Ausgangsfrage nach der Stellung des Anderen in der Geschichte zurück. Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei dem kooperativen Kommentar um eine solide Einführung in das erste große Hauptwerk von Lévinas handelt, die zudem an vielen Stellen Bezüge zu anderen Schriften des Autors herstellt und Verbindungen zu anderen Autoren eröffnet. Naturgemäß werden die bekannten Gedankenfiguren behandelt, die für Lévinas-Vertraute eher keine Neuigkeit darstellen werden. Darüber hinaus bietet das Buch aber auch Fokussierungen auf randständigere Aspekte des Werkes und besticht durch detail- und kenntnisreiche Analysen. Der im Titel angekündigte Geschichtsbezug wird dabei allerdings nur sporadisch aufgegriffen und darf durchaus auch weiterhin als Desiderat gelten