 Reading and Experience: A Philosophical Investigation
Reading and Experience: A Philosophical Investigation
Contributions to Hermeneutics (CONT HERMEN, volume 13)
Springer
2024
 Reading and Experience: A Philosophical Investigation
Reading and Experience: A Philosophical Investigation
 Briefwechsel 1922–1976 und andere Dokumente
Briefwechsel 1922–1976 und andere Dokumente
 Gadamer, Music, and Philosophical Hermeneutics
Gadamer, Music, and Philosophical Hermeneutics
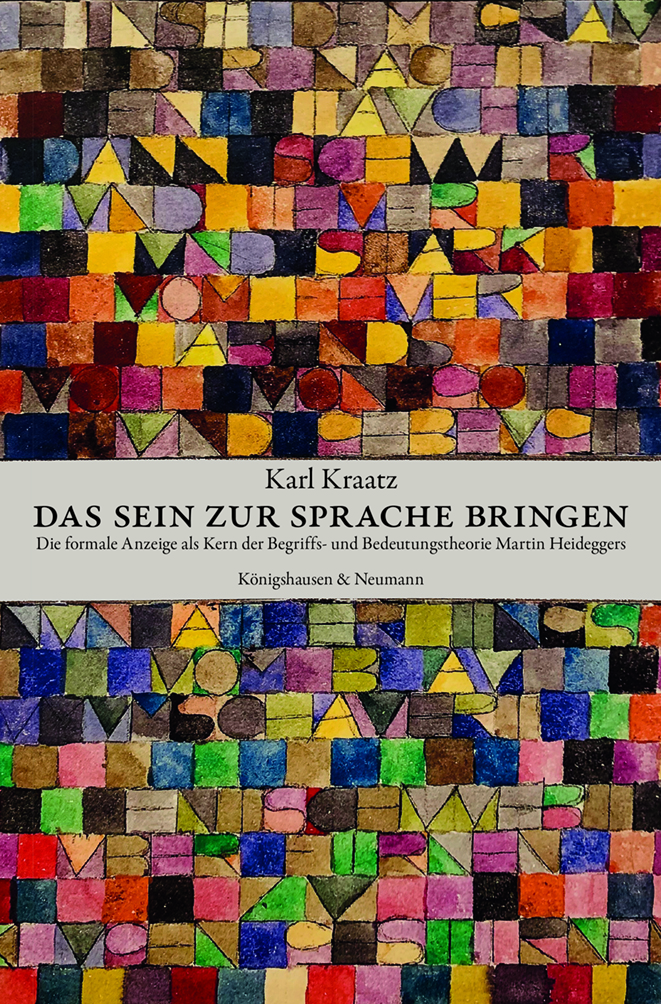 Das Sein zur Sprache bringen
Das Sein zur Sprache bringen
Reviewed by: Robert Reimer (Universität Leipzig)
In dem Methodenkapitel von Sein und Zeit schreibt Martin Heidegger, dass die Aufgabe der Phänomenologie darin besteht, „[d]as was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen.“ (Heidegger 2006, 34) Meistens ist es allerdings so, dass die Dinge, so wie sie sich von ihnen selbst her zeigen, nicht sehen gelassen werden. Insbesondere die Wissenschaften versuchen alles Seiende zu verobjektiviert und es einem einheitlichen materiellen Deutungsprinzip zu unterwerfen. Ein gutes Beispiel für ein solches oft unangemessen verstandenes Phänomen ist das Dasein selbst – also wir Menschen – und die uns zugehörigen Seins- und Lebensformen (ibid. 44). Genauer gesagt neigen wir selbst dazu, uns von dem Seienden her zu verstehen, was wir selbst nicht sind, was uns aber innerhalb der Welt ständig begegnet – also als einen materiellen Gegenstand unter vielen (ibid., 58). Damit wir die Dinge so sehen lassen, wie sie sich von ihnen selbst her zeigen (oder erscheinen), muss die Phänomenologie uns dabei helfen, einige der Verdeckungen zurückzuweisen, die wir als Erkennende mit unserer wissenschaftlich dominierten Begrifflichkeit an sie herantragen. Man könnte sagen, dass die phänomenologische Methode nach Heidegger eine Art mäeutisches Moment in sich trägt, das zur Selbstreflexion anregt: Mit ihrer Begrifflichkeit erschließt sie die Dinge auf eine Weise, dass wir sie (indem wir uns von unserem vorurteilsbehafteten Blick befreien) auch so sehen, wie sie sich von ihnen selbst her zeigen.
Um dieses wesentliche Moment der phänomenologischen Methode und Begrifflichkeit explizit zu machen, verwendet Heidegger vor allem in den früheren Schriften den Ausdruck ‚formale Anzeige‘. Karl Kraatz‘ Buch Das Sein zur Sprache bringen hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der formalen Anzeige in Heideggers Werk nachzuvollziehen, ihre Möglichkeit und Notwendigkeit zu begründen (Kraatz 2022, 25) sowie deren drei wesentliche Charaktere – den explikativen, den prohibitiven und den transformativen Charakter – zu bestimmen (ibid., 28-29). Explikativ ist die formale Anzeige, insofern formalanzeigende Begriffe die Zugangssituation sowie den Verstehensvollzug desjenigen ‚Ich‘ explizit macht, welches das jeweilige Phänomen verstehen will (ibid., 47, 137). Prohibitiv ist die formale Anzeige, insofern ein formal anzeigender Begriff die Einordnung des Phänomens in ein bestimmtes (wissenschaftliches) Sachgebiet abwehrt, wodurch der konkrete Bezug des Begriffs für das erkennende Ich offengehalten wird (ibid., 91; siehe auch Heidegger 1994, 141). Transformativ ist die formale Anzeige, insofern sich das Ich nach dieser negativen Abwehr in eines verwandelt, das die zuvor verdeckten Phänomene ‚eigentlich hat‘ und sieht (Kraatz, 2022, 193).
Kraatz behauptet, dass ein wesentlicher Wert seines Buches in dem Nachweis besteht, dass das Gefühl der Angst, das Heidegger in Sein und Zeit beschreibt, der Schlüssel dazu ist, um vor allem diesen dritten Charakterzug zu verstehen. Allgemeiner gesagt, sei die formale Anzeige abhängig von der Befindlichkeit der Angst, genauer: von deren spezifischen Erschließungscharakteren, in dem Sinne, dass die philosophische Sprache entsprechend ‚gestimmt‘ sein muss, um Sein formal anzuzeigen (ibid., 148). In diesem argumentativen Schritt besteht wohl das größte Wagnis des Buches, da damit Methodenanalyse (vor allem aus den früheren Schriften) und Daseinsanalye (aus Sein und Zeit) in einem konkreten Fall zusammen gedacht werden. Anders ausgedrückt liest Kraatz Sein und Zeit so, als sei eines der Phänomene, die das Dasein in seiner Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit auszeichnen – die Angst –, auch das Phänomen, das das Verstehen formal-anzeigender Begriffe im Allgemeinen kennzeichnet. Dies ist insofern zumindest ein Wagnis, als dass Heidegger, wie Kraatz selbst bemerkt, in Sein und Zeit nur sehr selten das Wort ‚formalanzeigend‘ verwendet und die formale Anzeige schon gar nicht als Methode einführt (ibid., 25, 127). Aber es ist eben auch eine Schwierigkeit, weil das Phänomen der Angst nicht so viele Parallelen zu den Charakterzügen der formalen Anzeige aufweist, wie Kraatz behauptet.
Diese Textbesprechung soll aus drei Abschnitten bestehen. Im ersten Abschnitt werde ich allgemein darauf eingehen, wie Kraatz die ersten beiden Charakterzüge der formalen Anzeige erschließt und definiert. Im zweiten Abschnitt werde ich kritisch beleuchten, wie laut Kraatz die Angst mit dem dritten Charakterzug der formalen Anzeige zusammenhängt und warum sie dem Verstehensprozess formal-anzeigender Begriffe zugrundeliegen soll. Im letzten Abschnitt werde ich noch kurz auf Teil V des Buches eingehen, worin es um die Einbettung der formalen Analyse in Heideggers allgemeine Bedeutungs- und Begriffstheorie geht.
1 Die formale Anzeige als explikative und prohibitive Methode
Das Buch beginnt mit dem wiederholten Hinweis darauf, dass die Phänomenologie einer spezifischen Mitteilungsmethode bedarf, die Heidegger ‚formale Anzeige‘ nennt. Konkret erfahren wir als Lesende zunächst, dass sie anti-wissenschaftlich verfahren muss, das heißt, alltagsnah und nicht verobjektivierend. Sie muss auf ‚das je eigene Ich‘ oder die je eigene Person und deren jeweilige Verstehenssituation aufmerksam machen (ibid., 42, 44, 47, 51). Damit soll der Tatsache entgegengekommen werden, dass bei dem Verstehensvollzug eines Begriffs schon immer ein bestimmtes alltägliches Vorverständnis des zu Begreifenden bei uns Erkennenden mitschwingt. Dieses kann den Bezug auf den Gegenstand – sein ‚Haben’ – leiten und ihm Bedeutung verleihen (ibid., 54). Während die wissenschaftliche Sprache diesen Bezug auf das Ich verdrängt, das mögliche alltägliche Vorverständnis verdeckt und so das Bedeutungshafte für das Ich zerstört (ibid. 72-74), ist es das Ziel der formalen Anzeige diesem bedeutungshaften Vorverständnis einen Raum zu geben. Daraus ergibt sich auch der Umstand, dass formal-anzeigende Begriffe Bezugsoffenheit aufweisen müssen, da sie erst „aus der jeweiligen Erfahrungs- und Interpretationsrichtung ihre konkrete faktische kategoriale Bestimmtheit“ erhalten (Heidegger 1994, 141).
So weit, so gut. Geht es bei der Explikation aber wirklich um das konkrete einzelne Subjekt und dessen spezifische Ansichten, so wie Kraatz das behauptet? Es ist gar nicht so leicht, diese Fragen zu beantworten. Kraatz selbst gibt zu, dass Heidegger scheinbar willkürlich entscheidet, ob bei dem Verstehensvollzug eines Begriffs wirklich das Ich als eigenstes mit dabei ist oder nur ein ‚idealisiertes Subjekt‘ (Kraatz 2022, 85). Eine Passage in Kraatz‘ Buch, die diese Schwierigkeit bei der Auslegung Heideggers beispielhaft aufzeigt, ist die Stelle, in der er auf Heideggers Diskussion des Begriffs ‚Geschichte‘ in Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks eingeht (ibid., 81-83; Heidegger 1993, 43-86). Heidegger unterscheidet dort zwischen verschiedenen Bezugsformen, die sich je nach Sinn des Begriffs ‚Geschichte‘ voneinander unterscheiden. So sagt Heidegger, dass in dem Satz „Mein Freund studiert Geschichte“ ein theoretischer Einstellungszusammenhang zwischen dem Studenten und der Geschichtswissenschaft zum Ausdruck kommt, worin die konkrete Bezugs- und Vollzugssituation des Freundes keine Rolle spielt. Kraatz wendet hier gegen Heidegger ein, dass auch in diesem Fall die persönliche Erfahrung, die Einstellungen und die Meinungen des Studenten für den Bezug auf die Geschichtswissenschaft bestimmend sein können (Kraatz 2022, 85). Und laut Heidegger können diese Dinge bei dem geschichtswissenschaftlichen Verstehen in der Tat mitschwingen, allerdings gehen sie in den Bezugssinn nicht mit ein (Heidegger 1993, 77). Meiner Meinung nach ergibt das durchaus Sinn, da es sich bei dem Studium der Geschichte um ein rein objektives Verhältnis handelt, da die konkreten eigenen Erfahrungen und Einstellungen (bspw. die eigene Religiosität) für das Verständnis des Forschungsgegenstandes (bspw. die religiöse Entwicklung Luthers) keine Rolle spielen. Und sie sollen auch keine Rolle spielen, aufgrund des kontextunabhängigen Charakters von Wissenschaften, wie Kraatz selbst anerkennt (Kraatz 2022, 101). Denn was hat Luthers konkrete religiöse Entwicklung schon mit meiner eigenen zu tun? Ganz anders sieht es bei der eigenen persönlichen Geschichte aus, für deren Verständnis trivialerweise die eigenen Erfahrungen und Einstellungen eine Rolle spielen.
Das zweite Moment, das laut Kraatz wesentlich die formale Anzeige kennzeichnet, ist das Moment des Prohibitiven, auf das Heidegger in der Tat explizit in mehreren Stellen, bspw. an Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, aufmerksam macht (Heidegger 1994, 141). Dort heißt es weiter: „Die formale Anzeige verwehrt jede Abdrift in […] blind dogmatische Fixation des kategorialen Sinnes von Ansichbestimmtheiten einer auf ihren Seinssinn undiskutierten Gegenständlichkeit.“ (Ibid., 142). Der Grund, warum die formale Anzeige so verfahren muss, ist, wie Kraatz richtig sagt, die Ruinanz oder, wie es in Sein und Zeit heißt, die Verfallenheit, die eine solche Abdrift in das Objektive begünstigt. Ruinant ist das Verstehen, wenn das (wissenschaftliche) Begriffssystem schon den Bezug hinreichend prädeterminiert, eine Einordnung in ein Sachgebiet vorgibt und damit das zu verstehende eigentliche Phänomen verdeckt. Stattdessen soll, wie oben bereits erwähnt, dieser Bezug für das Ich offengehalten werden, damit er durch es erneuert werden kann (Kraatz 2022, 105).
Nun bedeutet diese Bezugsoffenheit nicht, dass der Bezug ein willkürlicher wird, sodass der formal-anzeigende Begriff je nach Belieben auf alles und jeden verweisen könnte. Leider hilft Teil II von Kraatz‘ Buch allerdings nur wenig, um zu verstehen, wie genau der Bezug formal-anzeigender Begriffe funktionieren soll. Erst in Teil V, in dem es unter anderem um die Formalität der formalen Anzeige geht, gibt es dazu einige Hinweise. So schreibt Kraatz zunächst, dass die formale Anzeige inhaltlich nur die Bedingungen des Verstehensvollzugs vorgibt aber nicht den Vollzug vorwegnimmt (ibid., 213). Allerdings nimmt kein Begriff seinen Verstehensvollzug vorweg. Begriffe haben es so an sich, dass jeder Mensch sie selbst verstehen muss. Der entscheidende Punkt liegt wohl in der Vorgabe der Vollzugsrichtung, welche nur prinzipiell sein soll (ibid.). Dieses Prinzipielle wiederum wird später als das Sein des Seienden identifiziert, sodass die formale Anzeige wiederum als Anzeige des Seins des Seienden ausgewiesen wird (ibid., 225). Nun ist das Sein des Seienden in der Tat das, um das es der Phänomenologie nach Heidegger geht, allerdings scheint mit diesem Hinweis bei Kraatz eher das Was und nicht das besondere Wie des Bezugs bestimmt zu sein. Erst ein Blick in Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles verrät, dass damit durchaus etwas über das Wie des Bezugs ausgesagt wird: Das Sein des Seienden, auf das der Bezug gerichtet sein soll, ist keine irgendwie geartete oberste Seinskategorie, sondern ‚formalleer‘. Das bedeutet, dass es dem jeweiligen Phänomen selbst überlassen bleibt, wie der Modus der Verstehens beschaffen sein muss, sodass er nicht durch ein spezifisches Sachgebiet vorgegeben ist (Heidegger 1994, 60f).
Eine Schwierigkeit von Das Sein zur Sprache bringen besteht darin, dass der Autor selten Beispiele für den Verstehensvollzug formal-anzeigender Begriffe gibt. Das erschwert die Lektüre. Erst in Teil V gelingt mit der Erwähnung der Funktionsweise der Begriffe ‚Sorge‘ und ‚Dasein‘ in Sein und Zeit (Kraatz, 2022, 214) sowie der Besprechung von Heideggers dreistufiger Analyse des Begriffs der Langeweile in Die Grundbegriffe der Metaphysik (Kraatz 2022, 264ff) eine konkrete Veranschaulichung des Verstehensvollzugs formal-anzeigender Begriffe. Allerdings kommen diese Beispiele erstens zu spät und bleiben zweitens deutlich hinter den zweihundert Seiten vorhergehender theoretischer Analyse der drei Charakterzüge der formalen Anzeige zurück. Dass sich die Momente der formalen Anzeige durchaus recht einfach an einem Beispiel aufweisen lassen, möchte ich mit einer kurzen Betrachtung der Diskussion des Phänomens des Todes in Sein und Zeit demonstrieren.
Heidegger beginnt die Analyse des Todes direkt mit einer Abwehr: Wir sollen das eigentliche Phänomen des Todes nicht auf Basis der Beobachtung anderer verstorbener Menschen als ein Vorkommnis am Ende unseres Lebens verstehen (Heidegger 2006, 240). Stattdessen müssen wir selbst das Sein dieses Phänomens aus der uns je eigenen Vollzugs- und Erlebnisperspektive heraus begreifen, und zwar als etwas, das wir gar nicht erleben und wobei wir auch nicht vertreten werden können; der Tod, oder besser das eigentliche Sein-zum-Tode, bestimmt unser Leben vielmehr strukturell und verleiht ihm dadurch seine Ganzheit (ibid., 266). So zeigt sich an dieser Analyse des Todes zum einen das explikative Element, da Heideggers formal-anzeigendes Philosophieren die Leserinnen und Leser auf sie selbst zurückverweist und dem Vorverständnis ihrer eigenen Situation Raum gibt, denn der eigene Tod ist in der Tat ein durch Jemeinigkeit gekennzeichnetes Existenzial. Gleichzeitig verhindert Heidegger durch dieses Offenhalten des Bezuges die Abdrift des Verstehens in Fachgebiete wie die Biologie. Er beschreibt seine Methode auf diesen Seiten sogar selbst als eine sowohl positive als auch prohibitive (ibid., 260).
Die formale Anzeige ist nicht nur explikativ und prohibitiv, sondern auch transformativ. Laut Kraatz versetzt die formale Anzeige das verstehende Subjekt nicht in einen passiven Verstehensmodus, bei dem das Selbst des Subjekts in seinem Dasein unangetastet bleibt, sondern fordert es zur Verwandlung auf: „Der Verstehensvollzug ist gleichsam ein Vollzug einer Verwandlung.“ (Kraatz 2022, 181) Und in der Tat spricht Heidegger in Grundbegriffe der Metaphysik explizit davon, dass das erkennende Dasein von der formalen Anzeige aufgefordert wird, eine entsprechende Verwandlung zu vollziehen (Heidegger 2004, 421-430). Aber eine Verwandlung in was?
Heidegger diskutiert in diesen Textpassagen erneut das Phänomen des eigenen Todes und wendet sich gegen eine Verstehensweise, dergemäß dieses Phänomen ein vorhandenes Ding ist, das durch den Begriff vollumfänglich beschrieben wird. Aber der (eigene) Tod ist, wie bereits erwähnt, nicht als ein zu vorhandenes Ereignis zu verstehen. Stattdessen soll der Modus des Verstehens so sein, dass sich das erkennende Subjekt selbst in das Da-sein des jeweiligen Phänomens verwandeln muss, wie Heidegger sagt (ibid., 428). Das heißt, es muss das Phänomen selbst aus seinem zu-oder-in-diesem-Phänomen-Sein heraus verstehen. Ich habe vorhin bereits darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich bspw. verstehen will, worin der eigene Tod besteht, mich selbst als zum-Tode-seiend verstehen muss. In diesem transformativen Moment liegt auch der Grund, warum diese Begriffe anzeigend sein müssen, da sie ja ihre Konkretion nicht von selbst mitbringen, sondern eher „in eine Konkretion des einzelnen Daseins im Menschen hineinzeigen“ (ibid., 429; siehe auch Kraatz 2022, 198).
Wie formuliert Kraatz nun den transformativen Charakter der formalen Anzeige? Teil III und IV von Das Sein zur Sprache bringen wiederholen im Prinzip die beiden vorherigen Charaktere der formalen Anzeige – nämlich den der Abwehr und den der Verweisung auf das eigene ich. Allerdings führt Kraatz durchaus einen wichtigen neuen Aspekt in seine Analyse ein, nämlich den, dass Gefühle für die formal-anzeigende Begrifflichkeit entscheidend sind und dass die philosophische Sprache auf ihren Inhalt ‚einstimmen‘ muss, weil dieser nur in einer besonderen Stimmung zugänglich wird (ibid., 148, 179). Es stimmt, dass der transformative Zug, der zu einer eigentlichen Begegnung mit dem zu verstehenden Phänomen führt, durchaus so etwas wie eine Einstimmung in das Phänomen erfordert. Allerdings beharrt Kraatz darauf, dass das entsprechende Gefühl das der Angst sein muss.
Die Angst ist laut Kraatz dasjenige Gefühl, das den Menschen die ausdrückliche Selbstbegegnung ermöglicht (ibid., 129), die alltägliche ruinante Lebenstendenz unterbricht (ibid., 135) und ihm sein Freisein für das eigentliche Selbstsein offenbart (ibid., 144). Grund genug für Kraatz zu schließen, dass das, was er über die Angst gesagt hat, zugleich für die Funktionsweise und den Vollzug der formalen Anzeige selbst gilt (ibid., 158, 191) und dass die formale Anzeige wesentlich ‚beängstigend‘ ist (ibid., 148). Diese Textausschnitte und die ausführliche Besprechung des Angstphänomens in Teil III legen den Schluss nahe, dass die Angst für Kraatz tatsächlich das zentrale Gefühl des Verstehensvollzugs der formalen Anzeige ist. Allerdings relativiert Kraatz seine Aussagen auch. So spricht er oft davon, dass die Angst nur eines der Gefühle ist, die die Erschließungsfunktion der formalen Anzeige ermöglichen (ibid., 158, 167, 183, 233) und sagt sogar, dass zum Philosophieren nicht notwendigerweise bzw. nicht im wirklichen Sinne die Angst gehört (ibid., 235f). Solche Schwankungen machen es schwierig, den Autor auf eine kohärente Position festzulegen.
Nun könnte man auf Grundlage der obigen Beschreibung des transformativen Charakters in Die Grundbegriffe der Metaphysik in der Tat den Schluss ziehen, dass Heidegger selbst Methoden- und Daseinsanalyse zusammenführt, denn ich verstehe ein Phänomen nur dann eigentlich, wenn ich mich in demjenigen Seinsmodus, bzw. in derjenigen Stimmung befinde, die das jeweilige Phänomen ausmacht. In der Tat sagt Heidegger in Sein und Zeit, wie Kraatz betont, dass die Angst für die existenziale Analytik eine methodische Funktion übernimmt: So fungiert die Angst als erschließende Grundbefindlichkeit des Daseins (ibid., 165, 232, 241; Heidegger 2006, 185, 190-191). Das liegt allerdings daran, dass das Dasein in seiner Eigentlichkeit wesentlich in Angst ist. Daraus folgt nicht, dass die Angst den Verstehensvollzug formal-anzeigender Begriffe im Allgemeinen leitet. Nicht nur gibt es für eine solche Diagnose keine Belege in Sein und Zeit, sie steht auch im Konflikt mit der Rolle der Angst. Wir erinnern uns: Die formale Anzeige richtet sich gegen eine vergegenständlichende, Bedeutung zerstörende und theoretische Vereinnahmung des Verstehens durch die Wissenschaften und die damit einhergehende Verdrängung des alltäglichen, bedeutungshaften Vorverständnisses des erkennenden Ich (Kraatz 2022, 37-44). Zwar beschreibt Heidegger die Angst als etwas, das das Dasein aus der Flucht vor ihm selbst (in die Verfallenheit) vor es selbst zurückholt und es mit seinem In-der-Welt-Sein und seinem eigensten, freien Seinkönnen konfrontiert (Heidegger 2006, 194-191). Allerdings ist dasjenige, an das das Dasein verfallen ist und von wo die Angst es zurückholt, ausdrücklich nicht durch Wissenschaftlichkeit, Objektivität, Unbedeutsamkeit,[1] Theorie und Unalltäglichkeit gekennzeichnet, (ibid., 67) sondern durch Nützlichkeit, Zuhandenheit (und nicht nur Vorhandenheit) und Alltäglichkeit (ibid., 68-70, 167). Die Angst befreit das Dasein zwar von einer uneigentlichen Auslegung der Welt durch das öffentliche Man, aber dieses Man ist eben nicht notwendigerweise ein wissenschaftliches.
Darüber hinaus scheint mir das Phänomen der Angst, selbst wenn es Parallelen zu dem Verstehensvollzug formal-anzeigender Begriffe aufweisen würde, nicht hinreichend zu sein. Die Angst holt das Dasein aus seinem Verfallen-Sein an die Welt zurück, vereinzelt es und offenbart ihm so Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit als Möglichkeiten seines Seins (ibid., 191). Aber sie allein enthält noch kein proaktives Moment, welches doch den Verstehensvollzug in seiner Gänze kennzeichnet. Verfolgen wir die Daseinsanalyse in Sein und Zeit weiter, werden wir sehen, dass das zentrale Moment des Daseins in seiner Eigentlichkeit die Entschlossenheit ist, bei der die Momente der Angst, des Schuldigsein-Wollens und des Seins-zum-Tode zusammenlaufen. Sie ist das „verschwiegene, angstbereite Sichentwerfen auf das eigenste Schuldigsein“ (ibid., 297). In ihr ist das Dasein also nicht nur von den ‚Zufälligkeiten des Unterhaltenwerdens‘ durch das Man befreit vor das eigenste Seinkönnen gestellt (ibid., 310), sondern auch in das selbstbewusste Handeln und Verstehen zurückgebracht (ibid., 300). Auf die Entschlossenheit geht Kraatz aber gar nicht ein. Zwar verweist er zurecht darauf, dass die Angst dasjenige Moment ist, dass sowohl das Schuldigsein-Wollen und des Seins-zum-Tode stimmt (Kraatz 2022, 162-163; Heidegger 2006, 251, 277), allerdings macht dieser Befund ebenfalls noch nicht den Schluss notwendig, dass die Angst selbst, und nicht die Entschlossenheit, im Zentrum einer Analyse der formalen Anzeige als Ganzer stehen muss.
Bevor ich mit meiner Besprechung zum Ende komme, möchte ich noch kurz auf Teil V von Das Sein zur Sprache bringen eingehen. Teil V nimmt eine eigenartige Sonderstellung ein. Es handelt sich nicht mehr um ein weiteres Puzzlestück, das wir als Leserinnen und Leser brauchen, um die formale Anzeige zu verstehen – denn die Aufzeigung der Charakterzüge der formalen Anzeige soll in Teil IV abgeschlossen sein – sondern eher um eine Neubetrachtung der formalen Anzeige aus einer ‚sprachphilosophischen und begriffs- und bedeutungstheoretischen‘ Perspektive. Darin zeigt sich allerdings ein Problem im Aufbau des Buches. Auf der einen Seite wirkt der Teil buchstäblich angestückt. Immerhin gehen die ersten vier Teile aus der ursprünglichen Abschlussarbeit des Autoren von 2015 hervor; Teil V ist deutlich später entstanden (Kraatz 2022, 200). Auf der anderen Seite finden sich erst hier Ergänzungen und Beispiele, die für das Verständnis der einzelnen argumentativen Schritte in den ersten vier Teil schon wichtig gewesen wären. Eine Integration von Teil V in die anderen Teile wäre vielleicht besser gewesen.
Auffällig ist auch, dass Kraatz die beiden Begriffe ‚Sprachphilosophie‘ und ‚Begriffs- bzw. Bedeutungstheorie‘ homonym verwendet, auch wenn er dabei das Wort ‚Sprachphilosophie‘ durchgehend vorsichtig in Anführungszeichen setzt. Besser wäre es allerdings gewesen, genau zu klären, was beide Begriffe bedeuten und wie sie sich zueinander verhalten – im Allgemeinen und bei Heidegger. Sprachphilosophie kann zum einen als philosophische Methode verstanden werden, die die Normalsprache als Quelle für philosophische Erkenntnisse nutzt. Sprachphilosophie zu betreiben bedeutet hierbei, Erkenntnisse über die Bedeutung eines Begriffes mittels der Untersuchung der grammatischen Eigenschaften des Begriffes in alltäglichen Sprachkontexten zu gewinnen. Im Unterschied dazu kann die Sprache als philosophische oder alltägliche Mitteilungsmethode aber selbst zu einem Forschungsgegenstand für die Philosophie werden: In diesem Sinne wäre Sprachphilosophie als Philosophie zu verstehen, die untersucht, inwiefern (philosophische, wissenschaftliche oder alltägliche) Ausdrücke Bedeutung haben und sich auf Gegenstände beziehen. Schließlich kann ‚Sprachphilosophie‘ drittens auch noch als eine Philosophie verstanden werden, die die Rolle der Sprache als soziale Praxis und Seinsform philosophisch untersucht.
Meiner Meinung nach lassen sich Beispiele für alle drei ‚Arten‘ von Sprachphilosophie in Heideggers Texten finden, die in ihrer Funktion klar auseinander gehalten werden müssen. Der zweite Sinn von ‚Sprachphilosophie‘ ist wohl der für Kraatz interessanteste und auch derjenige, der am ehesten mit den Begriffen ‚Begriffs- bzw. Bedeutungstheorie‘ übereinstimmt. Und in Heideggers Ausführungen zur formalen Anzeige geht es in der Tat um die Frage, wie philosophische Begriffe sich auf die Dinge beziehen (sollen). Wenn Heidegger in Sein und Zeit allerdings zum ersten Mal über die Rede, das Gerede, das Auslegen, Hören, Schweigen, etc. spricht (Heidegger 2006, 160ff), dann philosophiert er über Sprache eher in diesem dritten Sinne von ‚Sprachphilosophie‘, da es sich dabei um Seinsmodi des Dasein handelt. Beispiele für den ersten Sinn finden sich eher in anderen Texten.[2]
Wie sieht es nun konkret mit Heideggers Begriffs- bzw. Bedeutungstheorie in diesem Teil von Kraatz‘ Buch aus? Im Grunde bezieht sich Kraatz hier erneut auf den Kern der Idee der formalen Anzeige: Formal-anzeigende Begrifflichkeiten zeigen die Phänomene so an, dass das erkennende Subjekt sie erst im konkreten entsprechend gestimmten Nachvollzug erschließt. Damit sagt Kraatz im Vergleich zu den vorangegangenen Teilen nichts Neues, findet aber durchaus klarere und deutlichere Formulierungen. Interessant ist dann auch noch der Hinweis, dass es sich bei der formalen Anzeige nicht um eine Gruppe von bestimmten Begriffen handelt, sondern um eine bestimmte Haltung im Umgang mit philosophischen Begriffen (Kraatz 2022, 230) – eine Haltung, die Heidegger in seinen methodologischen und begriffs- bzw. bedeutungstheoretischen Aussagen in der Tat zum Ausdruck bringt.
Kraatz‘ Buch hilft durchaus dabei, die Leserinnen und Leser auf die formalen Anzeige, so wie sie in Heideggers Texten entwickelt wird, richtig ‚einzustimmen‘. Man mag dem Autor auch glauben wollen, dass Heidegger in der Idee der formalen Anzeige eine raffinierte und ungewöhnliche Methode entwickelt, die eng mit seiner Daseinsanalyse verbunden ist. Das ergibt auch Sinn, weil dasjenige, was wir mit Heidegger vor allem verstehen wollen – das Dasein –, wir selbst sind, also verstehende Wesen. Auch wollen wir dem Autoren glauben, dass der Nachvollzug formal-anzeigender Begrifflichkeiten von einem erfordert, sich auf eine besondere Art und Weise auf das zu verstehende Phänomen einzustellen, wie das bei wissenschaftlichen Begrifflichkeiten nicht der Fall. Allerdings gelingt die exegetische Überzeugungsarbeit nur zum Teil. Das liegt zum einen daran, dass das Buch in einigen Detailfragen meiner Meinung nach falsch liegt. Zum anderen erschweren die redundante und theorielastige Argumentationsstruktur sowie die doch allzu stark an Heideggers eigene schwierige Sprache angelehnte Ausdrucksweise vor allem Leserinnen und Lesern, die nicht sehr mit Heidegger vertraut sind, leider das Verständnis.
Literatur
Heidegger, Martin: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt- Endlichkeit – Einsamkeit (Wintersemester 1929/30). Hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2004.
Heidegger, Martin: Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks (Sommersemester 1920). Gesamtausgabe Band 59, hrsg. von Claudius Strube. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1993.
Heidegger, Martin: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung (Wintersemester 1921/22). Gesamtausgabe Band 61, hrsg. von Walter Bröcker und Käte Bröcker-Oltmanns. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1994.
Heidegger, Martin: Sein und Zeit (1927). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
Kraatz, Karl: Das Sein zur Sprache bringen. Die formale Anzeige als Kern der Begriffs- und Bedeutungstheorie Martin Heideggers. Würzburg: Königshausen & Neumann GmbH, 2022.
[1] Ganz im Gegenteil. Für das Dasein werden die innerweltlichen Dinge erst unbedeutsam, wenn es sich ängstigt, weil sich erst dadurch die Welt in ihrer Weltlichkeit aufdrängt (Heidegger 2006, 187; siehe auch Kraatz 2022, 141).
[2] In Sein und Zeit sagt Heidegger interessanterweise, dass die philosophische Forschung auf ‚Sprachphilosophie‘ verzichten muss, um den‚ Sachen selbst‘ nachzufragen (Heidegger 2006, 166). Ich vermute, dass er sich hierbei in der Tat auf Sprachphilosophie in diesem ersten Sinne bezieht, da sich seine Kritik gegen eine Philosophie richtet, die einzig in der Sprache verharrt und das Verankertsein der Sprache in der Welt selbst nicht thematisiert.
Allerdings betreibt Heidegger auch hin und wieder Sprachphilosophie in diesem ersten Sinne. So bemerkt er in Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, dass es zu dem Substantiv ‚Philosophie‘ ein passendes direktes Verb gibt (‚philosophieren‘); bei den Substantiven ‚Biologie‘ oder ‚Physik‘ ist das nicht der Fall. Daraus schließt Heidegger, dass Philosophie selbst ein Verhalten ist, während es sich bei der Biologie und der Physik eher um Sachgebiete handelt (Heidegger 1994, 42-61). Kraatz verweist auch auf diese Stelle (Kraatz 2022, 50-51)
 The Gadamerian Mind
The Gadamerian Mind
Reviewed by: Vladimir Lazurca (Central European University, Vienna)
Introduction
Recent decades have witnessed a current of uncertainty surrounding the afterlife of Gadamer’s philosophy. The critical challenges posed by poststructuralism, postmodernism, and deconstruction certainly had the potential to relegate philosophical hermeneutics to the role of a precursor or, worse, a vanquished adversary. What is more, a similar sentiment had troubled Gadamer himself, even before publishing his magnum opus. Finishing work on Truth and Method in 1959, he wondered whether it had not already come ‘too late’. By then, the kind of reflection he was advocating would have been deemed superfluous, as other philosophical movements and reforms in the social sciences already appeared to have left the romantic conception of the Geisteswissenschaften in their wake (Gadamer 1972, 449; 2004, 555).
As is well known, Truth and Method stood the test of the 20th century and indeed became one of the most important works of its time. This year marks the 20th anniversary of Gadamer’s death, and it prompts an unavoidable question: does Gadamer’s thought remain ‘of its time’, or is it equipped for the challenges of our own? The ambition of the volume under review is to show that the reception and scholarship of Gadamer’s philosophy has been flourishing and that his influence remains felt within and beyond philosophy.
Aims
The Gadamerian Mind, edited by Theodore George and Gert-Jan van der Heiden, is the 8th volume in the Routledge Philosophical Minds. This series, currently encompassing 12 published titles and three forthcoming, aims to present a ‘comprehensive survey of all aspects of a major philosopher’s work, from analysis and criticism […] to the way their ideas are taken up in contemporary philosophy and beyond’ (ii). True to the series’ objectives, this volume promises to be a ‘comprehensive scholarly companion’ (4) and a ‘major survey of the fundamental aspects of Gadamer’s thought’ (i). It therefore focuses on the dominant themes of Gadamer’s main body of work, philosophical hermeneutics. On the other hand, the purpose of this collection is to also show that the scholarly reception of Gadamer’s philosophy has developed and increased in the decades since his death. Accordingly, in addition to tracing the diverse influence of his views in different areas of philosophy and other disciplines, the editors aim to chart new and emerging perspectives on his thinking in this ‘new and comprehensive survey of Gadamer’s thought and its significance’ (1).
Consequently, this collection promises to put forth a ‘portrait of the Gadamerian mind’[1] that comprises what they call an increase in being. The term is borrowed from Gadamer’s discussion of images: according to him, an image is more than a mimetic replica of the original, but involves a presentation of what is essential, unique or merely possible in it, hence an increase in being. The editors thus aim to offer much more than a mere replication and exposition of Gadamerian themes. However, at a cursory glance, these different aims might in fact seem divergent. On the one hand, the volume aspires to be comprehensive, therefore self-contained. As such, it will necessarily repeat the structure and at least some of the content of previous volumes with similar goals. Companion volumes, as is well known, tend to be rather conventional, both in format and subject matter. On the other hand, this volume aims to not only distinguish itself from existing scholarship, but also forward and develop Gadamer’s own thinking. Hence, there is a danger, given these objectives, for it to splinter off in different directions and lose coherence. It will soon become clear that this danger is only apparent.
Structure
The Gadamerian Mind is composed of 38 chapters divided into six sections and enclosed by a brief introduction at the start and a comprehensive index at the end. The sections closely follow the stated aims. Roughly speaking, the first two sections review the main concepts and themes that return throughout Gadamer’s work, predominantly – but not exclusively – in his philosophical hermeneutics. Sections three and four canvass the philosophical background, both contemporary and historical, of Gadamer’s work, providing readers with contextual information about the diverse influences on his thought and its contemporary audience and critics. Finally, the concluding two sections focus on the second goal of this collection, that of assessing the importance of Gadamer’s work in recent philosophy and beyond.
The volume opens with Overviews, a section surveying the intellectual background of Gadamer’s life and philosophy as well as showcasing the chief focal points of his work. The contributions in this first section explore aspects of Gadamer’s intellectual biography and life, as well as sketching out the main outline of his philosophical legacy. His commitment to humanism and its significance, the importance of poetry and art in general for his thinking, the ongoing theme of dialogue and conversation are all touched on in this section. A stand-out essay, which highlights an important and often overlooked subject is Georgia Warnke’s ‘Gadamer on solidarity’. In this remarkably detailed and illuminating article, Warnke collects the threads of Gadamer’s scattered remarks on solidarity and friendship into a general account. In dialogue with previous scholarship, she identifies the cardinal dimensions which articulate Gadamer’s conception of solidarity. What emerges is brought into sharper focus through comparisons with relevant recent and contemporary accounts.
According to Warnke’s reconstruction, Gadamer’s understanding of solidarity is that of a substantive bond with others that does not depend on affinities or similarities, and neither on subjective intentions or attitudes. She finds here a stark contrast with some recent approaches, such as Banting and Wymlicka’s, for whom solidarity is ‘a set of attitudes and motivations’ (2017, 3). In line with this definition, these authors look to various political institutions and policies which can reinforce the attitudes underlying democratic solidarity. As Warnke explains, from a Gadamerian perspective this project would have to seem futile. Given that he does not think solidarity is a matter of attitudes, he would contest that cultivating the relevant ones can foster it. Warnke proceeds to compare Gadamer’s account to Rorty (1989), Shelby (2005), Jaeggi (2001), and Habermas (2001, 2008) in a highly persuasive and concise chapter on Gadamer’s continued relevance and significance for contemporary debates in the philosophy of solidarity, identity, race, and public policy.
Overviews is followed by Key Concepts, a section devoted to a critical examination and assessment of the primary conceptual makeup of Gadamer’s acclaimed philosophical hermeneutics. The chapters contained here track the notions of truth, experience, tradition, language, play, translation, image (picture) and health. These are well-written by well-known scholars and provide an approachable and comprehensive introduction to these concepts. A particularly notable essay, and indeed relevant in the global circumstances of today, is Kevin Aho’s ‘Gadamer and health’.
In his contribution, Aho details the enormous impact Gadamer’s The Enigma of Health had within philosophy and explores the way Gadamer’s pronouncements reflect the views of medical practitioners. According to Aho, the core aim of Gadamer’s book is to liberate medicine from the scientific method that governs it in order to arrive at patients’ own experiences of their illnesses and bodies. For Gadamer, health is hidden, enigmatic, it is ‘the condition of not noticing, of being unhindered’ (1996, 73). Further, he claims that it does not consist in ‘an increasing concern for every fluctuation in one’s general physical condition or the eager consumption of prophylactic medicines’ (Gadamer 1996, 112). This, for Aho, reflects the transparency of our own bodies. What is especially noteworthy in Aho’s contribution is the detailed account of exactly how and to what extent physicians and medical professionals are echoing Gadamer’s views. There is ample evidence here, for Aho, that Gadamer can help lay the conceptual groundwork for reforming our understanding of health and care. Although this connection is not explored in the text, this article is especially important at a time where health is no longer defined along these lines, where sick bodies are asymptomatic, and a ‘condition of not noticing’ can characterize both illness and health.
Unfortunately, there is also a notable absence from Key Concepts. Certainly, there are several important concepts not treated in this section and one could make a case for their inclusion. For instance, the concepts of pluralism, phronesis or scientific method are also key to Gadamer’s philosophy and are absent here. But, in the editors’ defence, a collective volume is finite, and their selection can certainly be justified with respect to these and perhaps other notions.
There is, however, an omission for which this cannot be said. In their introduction, the editors state that Gadamer’s name has become synonymous with philosophical hermeneutics, a field ‘concerned with theories of understanding and interpretation’ (1). A chapter dedicated to the concepts of understanding and interpretation, therefore, both undoubtedly key concepts in Gadamer’s philosophy, should not be missing in a comprehensive scholarly companion, more so since Gadamer’s use of these concepts is known to cause confusion and controversy among scholars and critics alike. This is a regrettable omission for which the other chapters, for all their merits, cannot make up.
The third section is entitled Historical Influences and is devoted to outlining the most important philosophers who left their mark on Gadamer’s thought and to evaluating his own account of their views. The papers composing this part examine the importance of Plato, Aristotle, Kant, Hegel, Dilthey, and Heidegger for Gadamer’s thinking, undoubtedly the chief influences on his thought.
Francisco J. Gonzalez opens this section with ‘Gadamer and Plato: an unending dialogue’, a veritable tour de force of erudition. Not only is this paper a brilliant survey of Gadamer’s Plato studies and his significance for Gadamer’s own thought, but this article also details the extent to which the study of Plato’s dialogues played a key role in the development of Gadamer’s own philosophy. Gonzalez identifies the chief contributions of Gadamer’s commentaries and interpretations of Plato and investigates how his reading changed throughout his career. By subdividing Gadamer’s engagement with Plato in five distinct periods and analysing his hermeneutical approach to the study of the dialogues, Gonzales brings this ‘unending dialogue’ of the two philosophers into clear view. This paper’s discussion of the differences between these periods, the internal inconsistencies within them and the accounts of the parallel developments in Gadamer’s own philosophy in these periods are highly valuable to scholars of Plato and Gadamer alike.
The subsequent section, Contemporary Encounters, canvasses important conversations and debates between Gadamer and his critics about the possibility, nature, and limits of philosophical hermeneutics. The reader finds here all the usual suspects (Habermas, Derrida, Ricoeur, Vattimo) but will certainly be pleasantly surprised to see Paul Celan’s name mentioned among them. In his ‘Poem, dialogue and witness: Gadamer’s reading of Paul Celan’, Gert-Jan van der Heiden analyses a very important concern in Gadamer’s later philosophy, namely poetry. He specifically centres on the relation between dialogue and poem. According to Gadamer, they are two distinct modes of language, each with their own specific modality of disclosing meaning. What follows is a compelling discussion of this difference and a welcome addition to Gadamer scholarship. The focus on Gadamer’s interest in poetry is in general an important innovation to existing literature and can be seen throughout this volume.
A noticeable omission from this section, however, is a chapter on the Italian philosopher and jurist Emilio Betti. He and Gadamer had a private, epistolary debate and a lengthy public controversy, yet news of their engagement has not yet fully reached English-language scholarship. This is especially unfortunate as part of their disagreement revolves around central issues in hermeneutics. One such point of contention is the conceptual relation between understanding and interpretation, an issue concerning which these authors had opposing views and were sternly critical of one another. Another source of disagreement was the issue of validity and correctness in interpretation as well as the question of the diversity of interpretative criteria required by the variety of available hermeneutic objects. On the latter point, Betti criticized Gadamer for his undifferentiated view of objects of interpretation and argued that different items demand different hermeneutic approaches. But the deeper differences between these thinkers are yet to be thoroughly examined in Anglo-American academia and Betti’s unique voice is yet to be heard. I consider his omission from this collection regrettable for that reason.
In the penultimate section of this volume, Beyond Philosophy, the editors have compiled essays detailing the impact and significance of Gadamer’s work in areas and disciplines outside philosophy. From theology to jurisprudence, from medicine and healthcare to history and political science, Gadamer’s influence is thoroughly discussed here and, for many working within philosophy, brought into the open for the very first time. This entire section is undoubtedly a vital addition to existing scholarship and one of the areas where this volume more clearly innovates.
The collection concludes with Legacies and Questions, a section addressing significant philosophical currents that draw on Gadamer’s work, whether positively through further development, or negatively through critical engagement. The papers collected here deal with the encounter of Gadamer’s philosophy with postmodernism, analytic philosophy, race theory, metaphysics, and philosophy of culture. Particularly engaging and an excellent supplement to a growing literature is Catherine Homan’s article on Gadamer’s position within feminist philosophy.
In her ‘Gadamer and feminism’, Homan surveys Gadamer’s ambivalent reception by feminist philosophers. While many have criticized his position, others have viewed hermeneutics as fruitful for feminist purposes, adopting or adapting some of its cardinal tenets. In order to make sense of this varied reception, Homan enlists the help of Gadamerian hermeneutics itself. In particular, she claims that it is Gadamer’s insight into tradition that helps us understand feminist replies to his philosophy as well as what she provocatively calls the ‘tradition of feminism’. In her extensive treatment of the literature, Homan criticizes dominant strands of Gadamer reception in feminist philosophy by arguing that attending to tradition, rather than dismissing it, makes us better able to preserve valuable differences. Drawing hermeneutics and feminism together, she claims, invites more comprehensive interpretations and reinterpretations of both.
A regrettable lacuna of Legacies and Questions has to do with Gadamer’s reception in Anglo-America. Unfortunately, Greg Lynch’s ‘Gadamer in Anglo-America’ is not primarily concerned with the full range of this phenomenon. At first, this essay details Gadamer’s philosophical proximity to a well-known movement in the analytic philosophy of language, namely the so-called ‘ordinary language philosophy’. Lynch considers this starting point to be ‘the most natural spot in the analytic landscape’ in relation to which Gadamer’s philosophy ought to be discussed. After this initial section, which explores and assesses both significant commonalities and differences, Lynch proceeds to discuss the adoption of a Gadamerian-inspired perspective by two prominent analytic philosophers, Richard Rorty (1979) and John McDowell (1994). While Lynch’s treatment of this encounter and his critique of the adequacy of Rorty and McDowell’s reading of Gadamer are highly informative and valuable, what unfortunately does not emerge from this paper is the extent to which Gadamer’s reception in the ‘Anglo-American’ tradition of philosophy is still an ongoing process which continues to be relevant.
This is most visible when it comes to Gadamer’s proximity to Davidson and the ongoing exploration of their affinities in the philosophy of interpretation. Dialogues with Davidson (2011, ed. Jeff Malpas), an excellent volume on Davidson’s work in areas of philosophy of action, interpretation, and understanding, provides a good example of the fruitfulness and proportion of this endeavour. Nine out of the 21 chapters of this collection critically examine and assess this proximity, not to mention the Foreword, where Dagfinn Føllesdal states that Gadamer is a ‘natural point of contact’ with Davidson’s own views. In fact, Davidson himself claimed to have arrived ‘in Gadamer’s intellectual neighborhood’ (1997, 421). Dialogues with Davidson is a small sample of a new and growing debate in contemporary scholarship which focuses on drawing Gadamer and Davidson’s respective philosophies together and reaping the benefits of this comparison, thus bridging the unfortunate gap between the two major Western philosophical traditions. Gadamer is therefore very much part of an ongoing debate within analytic philosophy in recent decades and it is an oversight not to have included it in this collection.
The volume closes with a very detailed and useful index.
The Unity of the Collection
As mentioned at the outset, this collection might at first seem controlled by two sets of strings, comprehensiveness on one hand, innovation on the other. And the task of coordination appeared daunting. But has this volume nonetheless been able to strike a balance? Has it delivered a ‘portrait of the Gadamerian mind’ that is at once comprehensive and tracks the state of the art? In my view, it has, and the articles cited are some excellent examples of the fruits that can be borne of this twofold ambition. These and many other papers in this collection show that the two directions can be harmonized into a cohesive volume. Moreover, this collection is not only held together by the skeleton of its primary goals. The connecting tissues stretching out between the chapters are just as vital to the unity of the work.
A pertinent example of such a link, running through the various contributions, is the theme of conceptual innovation. Several of the articles undertake novel deconstructions of Gadamerian concepts, some authors opting at times for a reconstruction and retranslation instead. For instance, there is the increased and usefully articulated emphasis on the presentational, as opposed to the representational in Gadamer, not only as it relates to aesthetics (see James Risser, Cynthia R. Nielsen and Günter Figal’s chapters), but also to language, where, for Gadamer, it is being that comes to presentation (see Nicholas Davey and Carolyn Culbertson’s contributions). The careful articulation of the differences between these concepts is a highly valuable, if unintended, sub-debate in this volume.
Another instance of this new interest in conceptual analysis in Gadamer scholarship is David Vessey’s ‘Tradition’. In this extensive and comprehensive contribution, the author distinguishes between Gadamer’s Tradition and Überlieferung, two concepts identically translated, and usually indistinctly understood. Through his careful analysis, Vessey has not only disambiguated some interpretations of Gadamer, but contributed positively to the philosophical study of tradition in English-speaking scholarship.
On the other hand, some authors have proposed and explored renewed translations of Gadamerian concepts. One such instance is the concept of linguality (and lingual as an adjective), here presented as a translation of the Gadamerian Sprachlichkeit (for which linguisticality is the norm) but extending in use beyond the scope of Gadamer’s own philosophy. Linguality, with its overtones of orality, might indeed be better fitted for a philosophy which sees the essence of language in its fluid, spoken form of Gespräch, as opposed to linguisticality, which evokes fixed structures and stable grammars. Bildung as enculturation, as opposed to the more common cultivation, might again figure as such an example. I, for one, salute these conceptual innovations and look forward to the fruits they might bear in the future.
The way I see it, these ‘connecting tissues’, as I called them, constitute part of that increase in being promised at the outset. For it is not a simple terminological update. A philosopher’s words are the body, and not only the dress of his thought. As such, the examples mentioned contribute to uncovering – for an English-speaking audience – the full texture of Gadamer’s conceptual apparatus and the different layers of inferential relations present between concepts in the original. At the same time, they provide, as already mentioned, precise instruments for novel philosophical reflection. One could say, with Gadamer on one’s side, that this represents a positive appropriation and integration of his philosophy into a new idiom, filled with possibilities for future application and potential insights into issues Gadamer himself didn’t grapple with. In my view, this is an excellent way of keeping Gadamer and his philosophy alive through translation and appropriation, and of demonstrating their relevance.
On the topic of translation, we can also applaud the inclusion of a chapter on this issue as one of Gadamer’s key concepts. While one can argue whether the concept is key, this is certainly an area of research that has been growing backstage for a while. Although the author, Theodore George, does not mention this debate in his ‘Translation’, as that was not necessarily his purpose, his chapter will nevertheless bring this area of research into the mainstream, attracting new and significant contributions to this promising and burgeoning field. After all, a collection of this scholarly calibre does not, in spite of its goals, merely canvass the state of the art: it also establishes it. For this reason too it deserves praise.
The Gadamerian Mind and the chapters it contains are more than likely to act as signposts marking the relevance and significance of a given topic. This is exactly why I have said that the absence of certain topics is regrettable. But it is also why the presence of others is praiseworthy, such as those explored in Kevin Aho, Georgia Warnke, Theodore George, or Catherine Homan’s contributions.
Concluding Remarks
Undoubtedly, the Gadamerian Mind is of the highest scholarly value as a comprehensive companion to Gadamer’s thought and its significance. That his philosophy remains relevant is both successfully argued for and evident from the quality of the contributions collected here. But I have also been suggesting in the previous section that part of the value of this volume lies in its potential for impact, and it’s important, in my submission, not to underestimate its possible repercussions for future research. In other words, this collection both provides an increase in being in Gadamer scholarship, as I’ve argued above, and promotes and forwards it through its selection of treated topics and its academic stature. The Gadamerian Mind stands as an open invitation for scholars to explore and actualize the latent possibilities of Gadamer’s philosophy themselves.
Bibliography
Banting, Keith, and Will Kymlicka. 2017. The Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.
Davidson, Donald. 1997. ”Gadamer and Plato’s Philebus.” In Hahn 1997: 421-432.
Gadamer, Hans-Georg. 1996. The Enigma of Health: The Art of Healing in the Scientific Age. Translated by Jason Gaiger and Nicholas Walker. Stanford, CA: Stanford University Press.
Gadamer, Hans-Georg. 1972. ”Nachwort zur 3. Auflage.” In Gadamer 1993, vol. II: 449-478.
Gadamer, Hans-Georg. 1993. Gesammelte Werke. 8 vol. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Gadamer, Hans-Georg. 2004. Truth and Method. 2nd rev. edn. Translation revised by Weinsheimer J. and Marshall D.G. Continuum: London, New York.
Habermas, Jürgen. 2001. “The Postnational Constellation and the Future of Democracy.” In The Postnational Constellation: Political Essays, edited and translated by Max Pensky, 58– 112. Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, Jürgen. 2008. “Prepolitical Foundations of the Constitutional State?” In Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays, translated by Ciaran Cronin, 101– 13. Cambridge: Polity Press.
Hahn, Lewis Edwin. 1997. The Philosophy of Hans-Georg Gadamer. The Library of Living Philosophers. Vol. 24. Chicago: Open Court.
Jaeggi, Rahel. 2001. “Solidarity and Indifference.” In Solidarity in Health and Social Care in Europe, edited by R. ter Meulen, Will Arts, and R. Muffels, 287– 308. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Malpas, Jeff. 2011. Dialogues with Davidson. Acting, Interpreting, Understanding. London and Cambridge, MA: MIT Press.
McDowell, John. 1994. Mind and World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rorty, Richard. 1979. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rorty, Richard. 1989. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.
Shelby, Tommie. 2005. We Who Are Dark: The Philosophical Foundations of Black Solidarity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[1] Unfortunately, there is an ambivalence throughout this volume as to the precise meaning of the Gadamerian mind. For some, it is a placeholder for Gadamer himself, as an aggregate of ideas, interests, and commitments, for others it stands for ‘Gadamer’s theory of the mind’. So, it is unclear whether such a portrait would be of the former or the latter. Given the nature of the Philosophical Minds series, the editors’ intention is certainly for it to be of the former. But I believe a more thorough exploration of the latter would have been highly valuable and as such remains a missed opportunity of this collection.
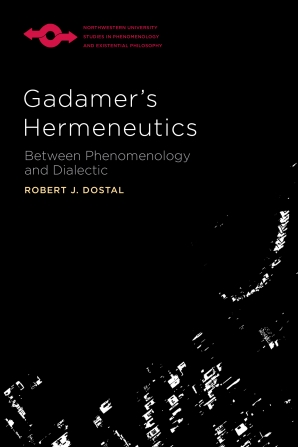 Gadamer’s Hermeneutics: Between Phenomenology and Dialectic
Gadamer’s Hermeneutics: Between Phenomenology and Dialectic
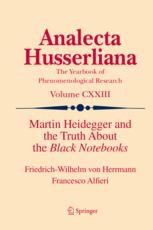 Martin Heidegger and the Truth About the Black Notebooks
Martin Heidegger and the Truth About the Black Notebooks
 The Gadamerian Mind
The Gadamerian Mind
 Subjectivity and Lifeworld in Transcendental Phenomenology
Subjectivity and Lifeworld in Transcendental Phenomenology