 The Possibility of a World: Conversations with Pierre-Philippe Jandin
The Possibility of a World: Conversations with Pierre-Philippe Jandin
Fordham University Press
2017
Paperback $28.00
144
 The Possibility of a World: Conversations with Pierre-Philippe Jandin
The Possibility of a World: Conversations with Pierre-Philippe Jandin
 Kreativität und Hermeneutik in der Translation
Kreativität und Hermeneutik in der Translation
 Philosophie und Frage
Philosophie und Frage

Reviewed by: Marco Cavallaro (Department Member of the Husserl-Archive Cologne; Visiting Researcher at Boston College)
Fausto Fraisopis neustes Werk gleicht dem ausgezeichneten Ergebnis einer ernsten philosophischen Untersuchung. Seine Stellung innerhalb der aktuellen Forschungslandschaft ist umso schwerer einzuschätzen, wenn man erkennt, dass das Buch auf eine originelle Offenlegung der Bedingungen der Möglichkeit jedes metaphilosophischen Nachfragens zustrebt. „Über Metaphilosophie“ lautet der Titel des ersten, kürzeren Bandes von Fraisopis Werk, in dem der Autor mit einem knappen und agilen Stil den Inhalt seines Unternehmens erläutert und den Leser bzw. die Leserin zum höheren Niveau der theoretischen Spekulation, die die ganze Abhandlung kennzeichnet, auf kleinen aber sicheren Schritten begleitet.
Fraisopis leitende Fragestellung bezieht sich nicht so sehr auf das, was Metaphilosophie ist, sondern darauf, welche Möglichkeiten die Metaphilosophie für das theoretische Denken und damit für die Philosophie überhaupt eröffnen kann. Diese Frage wird heute, nach dem Bankrott derjenigen metaphysischen Strebungen, die das Denken der abendländischen Kultur seit ihrer Geburt geleitet haben, höchst aktuell. Wie kann man sich noch heute auf die Notwendigkeit berufen, metaphilosophische Analysen durchzuführen und diese gar als das vitale Element des philosophischen Denkens auszuzeichnen? Das aus dieser Frage ausgehende Rechtfertigungsbedürfnis, das heute vor allem die Metaphilosophie betrifft, ist allgemeines Thema des ersten, einleitenden Bandes und erfährt im zweiten eine weitere Vertiefung.
Metaphilosophie lässt sich schlicht als „die Suche nach den Formen (oder den möglichen Formen) der Mathesis“ (S. 21) zusammenfassen. Als Ankerpunkt metaphilosophischer Untersuchungen dient Fraisopi seine phänomenologisch geprägte Frageanalyse – die man mit Recht als eine Alternative zu der hermeneutischen Stellung des Frageproblems in den einleitenden Kapiteln zu Martin Heideggers Sein und Zeit auffassen kann. „Die Frage“, so heißt es in der Einleitung zum ersten Band vom Fraisopis Werk, „ist das Moment, in dem das Denken sich zu dem Erfahrungshorizont in der Suche nach einer Antwort öffnet, und eo ipso muss die Frage der Anfangspunkt einer nicht metaphysischen Suche, einer Mathesis universalis, als universaler Wissenschaft sein“ (S. 17). Insbesondere das Kapitel II des ersten Teils des zweiten Bandes ist einer sorgfältigen „Logik und Phänomenologie der Frage“ gewidmet. Die Frage wird zunächst als Nach-Frage (petitio) bestimmt, was besagt, dass die Frage sich auf ein Objekt richtet, dessen Erfassung die Antwort zur Frage ermöglicht. Damit wird die Sättigung des in der Frage selbst enthaltenen Strebens, als ihr notwendiges Moment, ermöglicht. In Fraisopis Worten: „Das Ereignis der Frage zeigt uns einen völlig eigenen Modus der Intentionalität, der sein Noema, seinen Gegenstand, besitzt, der ihn jedoch nicht gemäß seinem Sein, seinem leibhaftigen Sein, sondern in der Offenheit des Möglichkeitsfeldes erfasst“ (S. 165).
Das ursprüngliche Thema der Nachfrage im Bereich des Spekulativen ist das, was jeden selbst zu allererst betrifft, nämlich das eigene Ich des jeweils Fragenden. Die ursprüngliche Frage ist dann: „Was/wer bin ich?“ Das Ich selbst stellt aber ein „extrem untypisches Deiktisches“ (S. 194) dar, zu dessen Erläuterung eine Bedeutungslehre im traditionellen Sinne nicht imstande ist. Der deiktische Charakter des Ich-Wortes bringt dann ein besonders „armes Phänomen“ (S. 203) im Mittelpunkt der fraisopischen „Meta-Egologie“ hervor, sodass diese aus einer diametral entgegengesetzten Perspektive zur metaphysischen Auffassung des Subjekts als res cogitans verstanden werden will. Denn die Frage selbst bereitet den Boden, aus dem heraus eine Schau des Ich erst möglich wird. In diesem Sinne, argumentiert Fraisopi, ist also nicht das Ich das Transzendentale, sondern die „Uröffnung, welche die Schau als psychologische Urdistanz begleitet und ihr vorausgreift“ (S. 227). Die von der Frage eröffnete spekulative Situation ermöglicht die „neutrale Festlegung der Schau“, d.h. die Auffassung der Schau und ihrer Bedingungen, unabhängig von jeder ontologischen Setzung und jeder ontologischen Vorinterpretation des anschaulich Gegebenen. Auf diese Weise entzieht sich die Meta-Egologie einer Ontologisierung des Ich sowie des psychischen und geistigen Lebens, die die traditionelle Metaphysik von Descartes her auszeichnet. Anstelle des metaphysischen Subjekts tritt deshalb der Begriff des Ich-Horizonts in den Vordergrund. Die Selbsterfassung des Ich zeigt sich in der Gestalt einer „Öffnung/Offenheit“. Denn „[d]as ‚Ich‘ ist nichts anderes als die Öffnung/Offenheit der Möglichkeit, das Gerichtet-Sein zu artikulieren. Besser gesagt: ‚Mein Ich‘ ist nicht zu unterscheiden von der ‚Öffnung/Offenheit-wohin‘ ich mein Gerichtet-Sein artikulieren kann“ (S. 238). Der Welthorizont, das Gegeben-Sein der weltlichen Gegenständlichkeiten in ihrem horizonthaften Charakter trägt nach dieser Auffassung die Bedeutung eines speculum, eines Sich-Widerspiegelns des Ich in der und durch die Welt. Die parusía der Welt ist gleichermaßen Selbstschau des Ich, Eröffnung jenes intentionalen Gerichtet-Seins, das sein Grundwesen ausmacht. Dieses Ich selbst stellt ein hybrides Wesen dar, sodass Fraisopi seine Selbstbeziehung als „hybride Selbstbeziehung“ bezeichnet. Der Gesamtbereich der intentionalen Akte macht eine modulare Mehrdimensionalität, ein „Multiversum“ aus, in dem die inflationäre Verbindung linearer Dimensionen und deren Faserung herrscht.
Der Frage nach dem Ich, die zur Meta-Egologie wird, folgt die Frage nach dem Wesenscharakter von dem, was man traditionell ‚Philosophie‘ genannt hat. „Was ist die Philosophie?“, fragt sich Fraisopi im zweiten Teil seines Werkes über die Meta-Theorie. Eine solche Fragestellung erweist sich umso dringender, nachdem die Unmöglichkeit der Metaphysik historisch sowie theoretisch geprüft wurde. Philosophie kann nicht mit der Metaphysik und ihren Problemen identifiziert werden. Im Gegenteil, sie versteht eine metatheoretische Dimension als einen Ort, wo Komplexe von Idealitäten (d.h. Theorien) als Gegenständlichkeiten aufgefasst werden können. Fraisopi befürwortet daher eine „Verflechtung zwischen dem Phänomenologischen und dem Metatheoretischen“ (S. 301), was letztendlich in diesem Werk den Stil seines Philosophierens auszeichnet. Das Wissen und seine Erwerbe, sprich die Theorien, werden aus dieser Perspektive als Gegenstände möglicher Erfahrung, und zwar theoretischer Erfahrung, aufgefasst. Die Meta-Theorie befasst sich mit der Form des Wissens überhaupt und folglich mit der Form der theoretischen Erfahrung. Das Originelle an Fraisopis Ansatz besteht unter anderen darin, die Mathesis selbst als eine weitere, hochrangige Form von Erfahrung zu kennzeichnen und die Meta-Theorie nicht als bloßes axiomatisches System von Regelungen für mögliche Verknüpfungen zwischen atomaren Wissenselementen, sondern in erster Linie als „eine Schau, eine Perspektive und nicht ein anderes Wissen, eine Theorie“ (S. 310) zu verstehen. Denn das Metatheoretische bestimmt sich als der Raum oder Ort, in dem die das Wissen selbst ermöglichende Öffnung stattfindet und in dem sich theoretische Strukturen (Theorien, Prinzipien, Gesetze, Axiome) als Gegenstände manifestieren können. Der Meta-Theorie entspricht eine neue Form der Anschaulichkeit, ein Theôrein, das kein „absolutes Schauen“ und kein „Blick von einem Nirgendwo“ darstellt, sondern dem „offenen Horizont einer reinen Schau“ (S. 335) näherkommt. Der metatheoretische Gegenstand bzw. der Gegenstand der metatheoretischen Anschauung, welche als solche toto caelo von der Anschauung des Wahrnehmungsdings verschieden ist, erweist keine ontologisch fixe morphologische Gestalt. Fraisopis Analyse der Form von Metagegenständen stützt sich vorwiegend auf Husserls phänomenologische Befunde bezüglich der Horizontalität der Gegenstandserfahrung sowie auf die ursprüngliche Idee der Mathesis universalis als Theorie von möglichen Theorienformen. Ein Meta-Gegenstand besitzt in diesem Sinne sowohl einen Innen- als auch einen Außenhorizont, welche zusammen die Gesamtheit der möglichen Bestimmungen seiner Selbstgegebenheit und der es umgebenden, miterfahrbaren Gegenständlichkeiten in der metatheoretischen Öffnung ausmachen. Fraisopi unterscheidet das Eidos des Meta-Gegenstandes als die morphologische Struktur seiner Erscheinung von seinem Logos, welcher seine Genese und die Entwicklungsgeschichte seiner sedimentierten Erfahrung widerspiegelt. Der originelle Gedanke dahinter ist nämlich die Einsicht, dass Theorien sowie theoretische Probleme „ein Eigenleben“ besitzen und keineswegs nicht-zeitlichen Entitäten eines platonischen Universums entsprechen (S. 358). Da aber Zukunft und Vergangenheit als solche lediglich einem Subjekt gegeben werden und dem Meta-Gegenstand an sich allein nicht inhärieren können, erweist sich einmal mehr die Notwendigkeit, die grundlegende Korrelation zwischen Subjekt und Objekt thematisieren zu müssen. Das aber soll mit dem Bewusstsein geschehen, dass Subjektivität eher einen Schauplatz darstellt, in dem Gegenständlichkeiten erscheinen und in dieser Erscheinung sich als solche konstituieren. Die Geschichte der Meta-Gegenständlichkeiten ist demgemäß in die Geschichte ihrer Schau für ein Subjekt eingeschrieben. Die Sedimentierung der Wissensformen korrespondiert und geht Hand in Hand mit einer Sedimentierung der Erfahrung auf einer subjektiven, noetischen Seite. Fraisopi geht von dem die Phänomenologie leitenden Prinzip aus, dass man „niemals das Wesen von ‚etwas‘ vollständig von der Erfahrung, die man davon macht, unterschieden erkennen kann“ (S. 378). Eine solche Perspektive eröffnet die „hermeneutische Dimensionalität“ (S. 369) des Meta-Gegenstandes und mithin der metatheoretischen Dimension, d.i. die „Strukturierung nach Beziehungen des Horizonts der metatheoretischen Erfahrung“ (S. 408). Eine solche Dimensionalität setzt den Meta-Gegenstand in Verbindung mit anderen Metagegenständen. Die Geschichte eines Meta-Gegenstandes kann sich auch aus der Umwandlung eines früheren Meta-Gegenstandes entwickeln und Gruppen von Metagegenständen können sich auf diese Weise etablieren. Das Metatheoretische als solches impliziert daher eine Mereologie, d.h. „die Auffassung jedes Erfahrungsgegenstandes innerhalb des metatheoretischen Horizonts, nach Verhältnissen von Ganzen und Teilen“ (S. 381). Gegenstände treten immer aus einem Feld oder einer „Region“ von Gegenständen heraus, die gemeinsame Wesensmerkmale aufweisen. Eine solche Sachlage erklärt sich aufgrund der „Regionalisierung der Strukturen“ von Gegenständen der Erfahrung, die dem Metatheoretischen eigen sind. Mereologie und Topologie vereinen sich, um damit eine „Mereotopologie“ zu formen.
Auch wenn das Metatheoretische kein Gegenstand ist, sondern eine kontextuelle Situation, d.h. eine Perspektive, schließt sich die Verbindung zwischen Meta-Theorie und Ontologie nicht völlig aus. Ein solches Verhältnis ähnelt laut Fraisopi dem, was bei zwei Figuren in einem Perspektiven- bzw. Gestaltwechsel vorkommt (vgl. S. 424). Die Gegenstandstheorie oder Ontologie als die Theorie des Gegenstandes überhaupt setzt einen metatheoretischen Horizont im Sinne einer thematischen Öffnung voraus. Die Ontologie verliert demnach jenen epistemischen Vorrang, den sie in der metaphysischen Tradition besaß. Aufgabe der Meta-Ontologie wird denn nicht eine Beschreibung der Gegenstandstheorie, sprich Ontologie, sondern vielmehr die, „zu erkennen, was genau die Gegenstandstheorie als Meta-Gegenstand entstehen lässt und bestimmt: die Grundfrage der Ontologie selbst“ (S. 440). Demzufolge wird die Ontologie als Meta-Gegenständlichkeit zu einem Relativen, das keine Letztbegründung durch sich selbst zulässt und daher eine absolute Bestimmung des Etwas grundsätzlich ausschließt. Diese ontologische Relativität besagt, dass zwischen den regionalen, materiellen und formalen Ontologien kein Vorrang und keine Hierarchie herrscht. Das führt nicht zu einem ontologischen Relativismus, sondern, wie Fraisopi argumentiert, nur zu einem „ontologischen Pluralismus als ontologischem Kontextualismus“ (S. 544, Anm. 6). Die Öffnung des metaontologischen Horizonts enthüllt also die „Ontologie als das, was sie ist, nämlich als einen kontextuellen Raum im Inneren, von dem es eine Deklination einer gewissen formalen Bestimmungsstruktur des ‚Etwas’ gibt“ (S. 519). Eine kontextuelle Ontologie dieser Art definiert die Kriterien, denen gemäß Individuationsprotokolle einzelner Gegenstände in einer vorgegebenen Region der Realität bestimmt werden können. Es besteht kein einseitiges Kriterium der Individuation und kein vorzüglicher Anschauungsmodus – in Fraisopis Worten: „Es gibt keine Individuationsmöglichkeit in der thematisch deskriptiven Öffnung der Metaontologie, kein metaphysisches Individuationskriterium, sondern nur ein kontextuelles (lokatives) Kriterium der Konkretheit“ (S. 532).
Der metatheoretische Gedanke der neuen Mathesis, die Fraisopi in diesen Seiten darlegt, prägt sich also grundsätzlich in einer „meta-metaphysische[n] Situation“, im Sinne einer „Situation der Neutralisierung von der Frage nach dem Realen“ (S. 546). Die Meta-Metaphysik ist also keine neue Metaphysik nach dem Austräumen vom Traum der traditionellen Metaphysik. Sie entspricht stattdessen der Sachlage, dass die Metaphysik „in ihrem Unsinn anerkannt und aufgehoben wird“ (ebd.). Diesem Zustand trägt ferner die metaontologische Modellierung der Systemformen der Individuation Rechnung, welche im letzten Abschnitt von Fraisopis Arbeit vorkommt. Die meta-ontologischen Modelle, d.i. die Modelle die sich im meta-ontologischen Raum zeigen, sind als topologische n-dimensionale Räume zu denken. Durch die Anwendung der Kategorientheorie zu den meta-ontologischen Modellen kann man die lebendige Interaktion, die Morphismen und die Transformationen zwischen solchen Gegenständen betrachten und streng deskriptiv beschreiben. Eine solche Modellierung ermöglicht, „die Konstruktionen und ihre Isomorphismen zu vergleichen, die zwischen den verschiedenen metaontologischen Strukturen der Metagegenstände fortbestehen“ (S. 606). Sie trägt daher zu einer holistischen Darstellung der Wesenszusammenhänge von Gegenständlichkeitsbestimmungskriterien bzw. Individuationsprotokollen bei. Eine solche Darstellung liefert den Schematismus einer Grammatik des Schauens, welche korrelativ eine Ontologie als Ordnungssystem der verschiedenen Gegenstandstypen und ihren Regionen ermöglicht. Darüber hinaus lehnt die metaontologische Modellierung die Rechtmäßigkeit der Schöpfung von einem Weltbild als einem einzigen Bild der phänomenalen Welt ab: „Es gibt kein Weltbild zu konstruieren, nur eine Topographie des Realen, sodass es durch die spiegelhafte (stets neumodellierbare) Beziehung zwischen den Wissensformen und ihren ontologischen Bildern hervortritt“ (S. 588). Ein solches Vorhaben wäre laut Fraisopi zum Scheitern verurteilt, da sich die Struktur der Welt als dynamisch und komplex charakterisiert und als solche die Basis jener monistischen und fixen Ontologie zerstört. Besonders an dieser Stelle ist, dass der Gedanke der Komplexität in Fraisopis Werk zentral wird. Die Komplexität und Dynamizität des Realen, welche uns die aktuellsten, wissenschaftlichen Erfindungen bezeugen, ziehen dem traditionellen metaphysischen Weltbild sozusagen den Boden unter der Füßen weg. Auf diese Weise rechtfertigt sich die Aufgabe einer Meta-Metaphysik und der korrelativen „konstruktivistischen Metaontologie“. „Der Skandal“, der, könnte man sagen, den fraisopischen Gedanken einer Meta-Philosophie ursprünglich provoziert hat, besteht darin, „dass die Ontologie noch an einen gewöhnlichen Charakter des Diskurses gebunden ist, der weder der Dimension der gewöhnlichen Erfahrung noch den komplexen und extrem raffinierten Modellierungen des Wissens zugehört, für die es nicht ausreicht, eine philosophische Wiederholung zu liefern, um ein profundes, spekulatives Verständnis davon zu bekommen“ (S. 601). Es handelt sich dabei auf keinen Fall um Einwendungen naturwissenschaftlicher Befunde in den philosophischen Diskurs. Denn das Denken der Komplexität lässt die Bestimmung dessen, was das Reale ist, grundsätzlich offen, und darin hebt es sich von dem Denken der traditionellen Wissenschaft, etwa der Galiläischen Naturwissenschaft, ab – welche übrigens metaphysische Voraussetzungen enthielt und sogleich aus solchen entstammte. Auf der Grundlage dieses ‚Offenlassens‘, das heißt, auf der Grundlage des intimen Bewusstseins der Unmöglichkeit einer letzten Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Realität, kann sich die Mathesis im Sinne einer Öffnung der Dimension des Spekulatives als Schau präsentieren.
Fraisopis Werk zeigt sich ambitioniert. Seine Absicht ist es, den Leser oder die Leserin dazu zu bringen, nicht weniger als die gesamte Aufgabe des theoretischen Denkens neu aufzufassen und ihn oder sie auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, eine Mathesis universalis für die Menschheit zu konstruieren. Wie alle großen Gedanken und Philosophien wird voraussichtlich auch für Fraisopis die Zeit den entscheidenden Faktor für den Erfolg seiner Arbeit darstellen. Zeit ist auch das, wonach der Leser oder die Leserin dieser mächtigen zweibändigen Arbeit gefragt wird. Nach unserer bescheidenen Überzeugung wird aber seine oder ihre Zeit exzellent investiert.
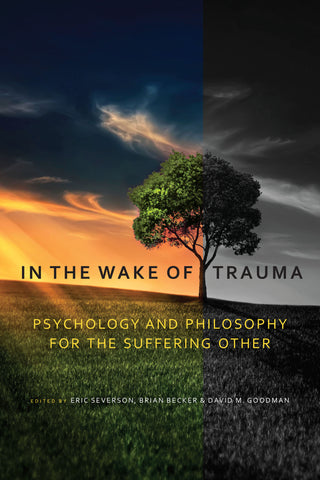 In the Wake of Trauma: Psychology and Philosophy for the Suffering Other
In the Wake of Trauma: Psychology and Philosophy for the Suffering Other
 Aesthetics, Metaphysics, Language: Essays on Heidegger and Gadamer
Aesthetics, Metaphysics, Language: Essays on Heidegger and Gadamer
Reviewed by: Diego D'Angelo (Katholieke Universiteit Leuven)
Sono pochi, forse pochissimi gli autori di lingua italiana in grado di muoversi agevolmente nel panorama filosofico internazionale. Molti si astengono persino dal provarci. Tanto più va lodato e apprezzato, allora, il riuscito tentativo di Stefano Marino di pubblicare anche in lingua inglese, come dimostra questo volume, uscito di recente per Cambridge Scholars Publishing, su estetica, metafisica e linguaggio in Heidegger e in Gadamer. Non si tratta peraltro della prima pubblicazione di Marino diretta ad un pubblico internazionale: ricordiamo qui il volume, risalente 2011, Gadamer and the Limits of the Modern Techno-Scientific Civilization (Peter Lang, Francoforte sul Meno), nonché il saggio in lingua tedesca Aufklärung in einer Krisenzeit: Ästhetik, Ethik und Metaphysik bei Theodor W. Adorno, pubblicato nel 2015 (Kovac Verlag, Amburgo).
La raccolta di saggi qui in questione continua dunque un discorso di apertura nei confronti della ricerca filosofica in lingue che non siano unicamente quella italiana. E si nota che, qui, Marino si muove con coerenza, affrontando soprattutto temi legati all’estetica e alla metafisica, rivolgendo la propria attenzione ad autori classici della tradizione tedesca del Novecento: Adorno, Heidegger e Gadamer, soprattutto, per quanto proprio questo volume contenga un’apertura anche verso il pensiero – diretto soprattutto alla politica – di Hannah Arendt, nonché al discorso anglofono di John McDowell e Richard Rorty. In questa recensione forniremo dunque alcune osservazioni contenutistiche a proposito dei cinque capitoli che costituiscono il volume, chiudendo poi con alcune osservazioni critiche di carattere generale. Tutti i testi tranne il primo, che è un contributo originale al volume, sono infatti rimaneggiamenti, a volte anche sostanziali, di articoli pubblicati in precedenza.
Il saggio di apertura, Gadamer and McDowell on Second Nature, World/Environment, and Language, cerca di ricostruire il debito, espressamente riconosciuto da McDowell stesso, che alcune posizioni di Mind and World – uno dei libri più dibattuti degli ultimi vent’anni – hanno nei confronti del pensiero di Hans-Georg Gadamer, e in particolare del suo capolavoro Wahrheit und Methode (Mohr Siebeck, Tubinga 1960). Nella ricostruzione di Marino, questo debito è individuabile soprattutto nei temi della seconda natura, del mondo (ambiente) e del linguaggio. Infatti, McDowell si riferisce espressamente a Gadamer, per il quale, nella lettura che ne dà il filosofo sudafricano, “the human experience of the world is verbal in nature” (p. 10; le indicazioni del numero di pagina in questo formato si riferiscono sempre, nel testo seguente, al libro preso in esame). Partendo da qui, Marino individua somiglianze e corrispondenze (cfr. p. 13) tra i due autori che ci consentono di vedere il discorso di entrambi sotto una luce nuova, in grado di chiarifica in particolare la genesi filosofica dei concetti di mondo e mondo ambiente: se è vero che McDowell si rifà a Gadamer per questi concetti, e che questo legame è riconosciuto dalla maggior parte degli studiosi, il merito di Marino sta nel connettere questo legame, a sua volta, agli autori cui Gadamer stesso si ispira per il suo concetto di mondo (cfr. p. 23), restituendo così al concetto tutta la sua complessità anche dal punto di vista della storiografia filosofica.
Un approccio simile, legato alla ricostruzione di punti precisi di storiografia filosofica, è perseguito anche nel secondo saggio, Gadamer on Heidegger: The History of Being as Philosophy of History. Se prima si trattava soprattutto di ricondurre concetti adoperati da McDowell alla loro fonte in Gadamer, e poi di vedere da dove Gadamer aveva a sua volta tratto certe linee del pensiero, ora è proprio questo secondo aspetto a venir enfatizzando, mostrando come Gadamer sia, nella sua filosofia della storia, debitore alla cosiddetta “storia dell’essere” di cui parla l’Heidegger degli anni ’30-’40. Eppure, questo “debito” è soprattutto di carattere negativo: secondo Marino, Gadamer recupera alcuni temi “particolari” della storia dell’essere, rigettandone l’impianto concettuale generale (cfr. p. 50). In particolare, Marino individua tre motivi. Il primo, di carattere filologico, è che la violenza con cui Heidegger interpreta altri filosofi per iscriverli nella sua storia dell’essere è, secondo Gadamer, un atto “barbarico” (cfr. p. 51). In secondo luogo, Gadamer rifiuta, secondo la lettura di Marino, l’esistenza, postulata da Heidegger, di un linguaggio unitario della metafisica che andrebbe superato (p. 52). In terzo luogo, legando Heidegger a Hegel, Gadamer è essenzialmente scettico nei confronti dell’unificazione forzata della storia della filosofia sotto l’egida della “dimenticanza dell’essere”: questo introduce una teleologia nella storia che Gadamer non può sostenere, secondo Marino. Discutendo anche alcune conseguenze che questa impostazione porta con sé per la questione estetica, cioè per la questione relativa al ruolo dell’arte nella contemporaneità, il saggio si chiude mettendo il luce come, forse, il debito di Gadamer nei confronti di Heidegger sia meno diretto di quanto si tenda comunemente a pensare (p. 63).
Il terzo saggio, Gadamer’s and Arendt’s Divergent Appropriations of Kant: Taste, Sensus Communis, and Judgment, ricostruisce un altro momento di questa critica ad una storiografia basata sui “debiti filosofici”, se si può dire così: Marino vuole, in effetti, anche in questo caso mettere in luce soprattutto le divergenze tra Arendt e Gadamer. Le loro letture della Critica del Giudizio, infatti, sarebbero addirittura “opposte” (p. 76): sintetizzando l’opposizione, spiega Marino, “Kant is praised by Arendt for having politicized some basic aesthetic concepts, but he is criticized by Gadamer for having depoliticized and aestheticized those same concepts!” (p. 77, corsivi ed enfasi nell’originale). Non si tratta, però, di semplici errori di interpretazione da parte dei due filosofi del Novecento: piuttosto, la storia delle ricezioni kantiane è una storia fatta di “productive misunderstandings” (p. 79), di cui il presente non è che un esempio.
Il quarto saggio presentato nel volume porta il titolo Gadamer’s Hermeneutical Aesthetics of Tragedy and the Tragic, ed è l’unico a non seguire già dal titolo la struttura del confronto tra due (o più) autori della storia della filosofia. Si tratta in questo caso, infatti, piuttosto di un’analisi concettuale in senso stretto: Marino si dedica ad una disamina del modo in cui Gadamer pensa e interpreta la tragedia e il tragico, un tema tradizionalmente poco esaminato (p. 85). Marino sposta il concetto di tragedia al centro del pensiero gadameriano, ricostruendone il ruolo giocato anche in Verità e Metodo: la tragedia, così la tesi dell’Autore, dimostra in maniera pregnante l’irriducibilità dell’esperienza umana all’approccio scientifico (p. 87). La tragedia sorge infatti dall’incontro/scontro tra l’umano e il divino (p. 88), ma non è riducibile unicamente a questa origine (p. 99), andando, nel suo sviluppo, al di là di essa. Gadamer ci consente, infatti, di riconoscere l’origine religiosa della tragedia senza negarne il valore estetico autonomo.
In conclusione, il volume ritorna alla struttura binomiale dei saggi precedenti, concentrandosi su Heidegger and Rorty: Philosophy and/as Poetry and Literature. Cerando di superare l’impasse che ha costituito buona parte dell’attrito tra filosofia analitica e filosofia continentale, ossia l’accusa rivolta dalla prima alla seconda di essere troppo vicina alla letteratura e poco al rigore scientifico, Marino decide di interrogare i massimi rappresentati di una filosofia contaminata con la letteratura: Heidegger perché nessun autore ha mai avvicinato così tanto poesia e filosofia (p. 107), e Rorty perché egli stesso vede la sua filosofia “come” letteratura (p. 108). Anche qui Marino ricostruisce il debito di Rorty nel confronti di Heidegger, concludendo però in modo fortemente critico: la lettura rortiana di Heidegger è – uso l’indicativo perché mi sembra difficile non concordare, specialmente alla luce delle ultime pubblicazioni e degli esiti della ricerca internazionale – “hermenutically careless and does not adhere to Heidegger’s own text” (p. 114). Purtroppo l’articolo si chiude, a mio parere, troppo presto, mancando di discutere se, effettivamente, da un punto di vista sistematico, l’idea di filosofia come letteratura sia davvero perseguibile.
In generale – sia detto in chiusura – l’approccio di Marino non vuole affrontare questioni di carattere teoretico-sistematico, ma solo fornire una disamina storiografica: egli stesso riconosce che si tratta di un “comparative approach” (p. 5). In tal senso, i limiti della lettura sono chiaramente definiti fin dall’inizio. Ciononostante, il lettore rimane con un certo amaro in bocca proprio per la mancanza di una discussione più approfondita di certi punti proprio in una prospettiva sistematica. Nel momento in cui, in effetti, l’Autore si ripromette di superare il “gap” tra analitico e sistematico, come afferma con chiarezza nell’Introduzione (p. 6), questo obiettivo sembra mancato: come si può, in effetti, istituire, da parte continentale, un discorso con la filosofia analitica – per altro, auspicabilissimo, se non addirittura necessario al giorno d’oggi – concentrandosi su questioni di storiografia? Certamente il tentativo sviluppato nel primo saggio di ricollegare espressamente John McDowell al pensiero di Gadamer è lodevole anche sotto questo punto di vista, ma non è forse abbastanza per rinfocolare un discorso tra due tradizioni. Lo stesso valga per l’ultimo saggio, riguardante appunto il problema della filosofia e/come letteratura, che lascia la questione in sospeso.
Al di là di questo limite, che è, come detto, intrinseco all’approccio esplicitamente adottato dall’autore, la “storiografica comparatistica” sviluppata qui da Marino ha grandi pregi: innanzitutto, la chiarezza espositiva; in secondo luogo: l’onestà intellettuale di restringere chiaramente a pochi concetti le proprie analisi, senza ricadere nella retorica roboante di certa letteratura; e infine, di presentare la tradizione filosofica italiana (buona parte dei contributi scientifici che Marino cita sono infatti di area italiana) al pubblico internazionale, un’impresa che, pur nei limiti accennati, non si può che lodare.