 Sport als Widerfahrnis: Phänomenologische Erkundungen
Sport als Widerfahrnis: Phänomenologische Erkundungen
Neue Phänomenologie (Band 34)
Karl Alber
2023
Paperback 79,00 €
340
 Sport als Widerfahrnis: Phänomenologische Erkundungen
Sport als Widerfahrnis: Phänomenologische Erkundungen
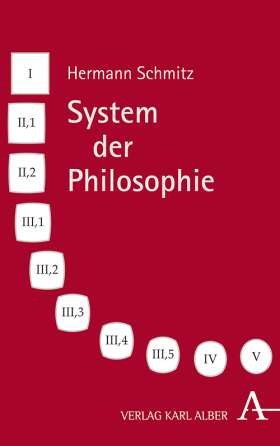 System der Philosophie (10 Bände im Schuber)
System der Philosophie (10 Bände im Schuber)
 Wie der Mensch zur Welt kommt
Wie der Mensch zur Welt kommt
Reviewed by: Jonas Puchta (University of Rostock)
Nach sechzigjähriger Schaffenszeit widmet sich Hermann Schmitz, der Begründer der Neuen Phänomenologie, in seinem 56. Buch der Individuation der Person als „Geschichte der Selbstwerdung“. Dabei entfaltet er sein Denken nicht grundsätzlich neu, sondern reformuliert Grundthemen der Neuen Phänomenologie wie das „affektive Betroffensein“, den „Leib“ oder die „Zeit“, die in zehn Kapiteln den „Zugang zur Welt“ der Person ersichtlich werden lassen. Zwar sind die Kapitel auch unabhängig voneinander lesbar, jedoch so konzipiert, dass sich bei sukzessiver Lektüre die „Selbstwerdung“ des Menschen nachvollziehbar entfalten soll.
Der Weg zur Selbstwerdung setzt ein mit dem „affektiven Betroffensein“, das stattfindet, wenn jemanden etwas spürbar so nahegeht, dass er auf sich selbst aufmerksam wird. (13) Dafür ist kein bestimmtes Denk- oder Reflexionsvermögen von Nöten, sodass auch schon Tiere oder Säuglinge affektiv betroffen sind. (Ebd.) Die Tatsachen des affektiven Betroffenseins sind für Schmitz subjektive Tatsachen, die er von den objektiven unterscheidet. Während subjektive Tatsachen ausschließlich die Person aussagen kann, die auch tatsächlich spürbar betroffen ist, können objektive Tatsachen von jedem ausgesagt werden, der ausreichend Informationen über den Sachverhalt besitzt (13, 15f.). Objektive Tatsachen umfassen beispielsweise den Blick eines distanziert protokollierenden Beobachters, während die subjektiven Tatsachen den unmittelbar Getroffenen nahegehen. (16, 19f.) Die Missachtung der Subjektivität in der Philosophiegeschichte führte, so Schmitz, zu einer Spaltung des „wirklichen Subjekts“ in ein erscheinendes empirisches und ein metaphysisches transzendentales Subjekt, das von der Lebenswelt des Menschen gänzlich unabhängig ist, und wird somit zur Grundlage „aller möglichen idealistischen Erkenntnistheorien“. (20f.) Das affektive Betroffensein soll dabei zugunsten von Konzepten der Seele oder des Bewusstseins übersehen worden sein, die Schmitz anhand seiner Analysen der Leiblichkeit und der Gefühle überflüssig machen will. (23f.)
Dazu beleuchtet er zunächst im zweiten Kapitel die Atmosphären des Gefühls als eine Quelle des affektiven Betroffenseins. Dabei will Schmitz über die philosophische Tradition hinausgehen, wobei er Kants Position kritisiert, Gefühle als bloße Lust oder Unlust aufzufassen und Brentano und Scheler vorwirft, diese auf intentionale Akte zu reduzieren. (37) Dafür sei es erforderlich, sich in „phänomenologisch haltbarer Weise“ zu vergewissern, wie Gefühle dem Menschen begegnen. (Ebd.) Atmosphären wie Zorn, Freude oder Schuld ergreifen den Leib spürbar so, dass die Person immer erst nachträglich zum Gefühl Stellung beziehen kann. (26, 28) Die „Macht“ der Atmosphären besteht im Moment der Ergriffenheit, wenn dem zunächst passiv Betroffenen bestimmte „Bewegungssuggestionen“ eingegeben werden und dieser so dem Gefühl anfänglich unterworfen ist. (47) Diese spürbaren Bewegungen oder Richtungen geben dem Ergriffen zum Beispiel gewisse Haltungen oder Impulse ein, wie es am gesenkten Kopf eines Trauernden zu beobachten ist. (Ebd.) Die „Gesinnung“ als aktives Empfangen des Gefühls, welches auch schon bei Tieren vorhanden ist, stellt sich als bestimmte präpersonale Art des Sich-Einlassens auf das Gefühl heraus (27f.), wenn sich zum Beispiel auf die Trauer weinerlich oder standhaft eingelassen wird. Erst in der darauffolgenden aktiven personellen Stellungnahme im „Dialog“ mit dem Gefühl ist es aber möglich, einen „personalen Stil des Fühlens“ als Teil der personellen „Fassung“ zu entwickeln, die zwischen „personaler Regression“ und „personaler Emanzipation“ vermittelt. (27, 38, 107) Die Stellungnahme variiert dabei zwischen einer Preisgabe an das Gefühl, wenn sich der Betroffene von diesem mitreißen lässt oder im Widerstand, bei dem sich der Macht der Ergriffenheit entzogen wird. (27f.) Die „Kunst der Bewältigung“ des Gefühls besteht für Schmitz darin, die Zeit zwischen Ergriffenheit und Stellungnahme kurz zu halten (48), also frühzeitig die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Gefühlsmacht wahrzunehmen, wobei eine konkrete Beschreibung dieses Umgangs ausbleibt.
Wie Schmitz im dritten Kapitel verdeutlicht, ist das affektive Betroffensein nicht nur für die Wirklichkeitsgewissheit, sondern auch für die Lebensführung von Bedeutung. (52) Die „Autorität der Gefühle“ wie auch die „Evidenz von Tatsachen“ sind Möglichkeiten, die Verbindlichkeit von Normen geltend zu machen. Gefühle haben im Moment der Ergriffenheit eine Verbindlichkeit von Normen mit der „Autorität unbedingten Ernstes“, welche die Person vor eine große Verantwortung im Handeln stellt. (53) Auf dem „höchsten Niveau personaler Emanzipation“, das Schmitz auch mit der „Vernunft“ gleichsetzt, gilt es zu überprüfen, ob sich der Evidenz oder der Autorität zu entziehen oder zu unterwerfen ist, ohne dabei von einer ethischen Handlungsmaxime auszugehen, die auf jede Situation gleichermaßen anzuwenden ist. (54, 60) In dieser Hinsicht wird der „Vernunft“ wie auch dem Rationalismus ihr Recht eingestanden, wenn es „angemessener Informationen“ oder der sinnvollen Einschätzung über eine Sachlage bedarf. (55) So muss beispielsweise der Wissenschaftler, der bei seiner Arbeit von Zorn oder Eifer ergriffen ist, sich zugunsten seiner Erkenntnisse von diesen Gefühlen freimachen. (Ebd.) Daran anschließend geht Schmitz beiläufig im vierten Kapitel der Bedeutung der „Autorität der Gefühle“ im Christentum nach, das er von der Metaphysik losgelöst sehen will. (57, 62) Religion wird verstanden als „Verhalten aus Betroffensein von Göttlichem“ (57) und ist damit ursprünglich immer mit einer spürbaren Erfahrung verbunden und nicht auf bloße Lektüre oder Rezeption heiliger Schriften zu reduzieren. Göttliche Gefühle entfalten ihre Kraft aus der ihnen eigentümlichen Autorität unbedingten Ernstes (59), sind aber auch eingebunden in unübersichtliche Situationen. In diesen werden die Gefühle oftmals als „Plakatierungen“ – der Begriff ist hier frei von negativen Konnotationen zu verstehen – anschaulich „zusammengefasst“, worunter Schmitz vor allem Feste, Symbole, Personen, aber auch die Götter selbst versteht. (60f.) Ohne sich als Christ oder zur Religiosität zu bekennen, hält er dem Christentum zugute, die Autorität eines Gefühls mit unbedingtem Ernst, wie der Liebe, dem gegenwärtigen „ironistischen Zeitalter“ entgegen zu halten, das sich in einer haltlosen Beliebigkeit des „Anything goes“ oder der „Coolness“ verrennen soll. (62f.)
Alles affektive Betroffensein ist leiblich spürbar vermittelt, weshalb der Leib als wesentlicher Ausgangspunkt der menschlichen Lebenserfahrung vom äußeren sicht- und tastbaren Körper, der zum Beispiel Gegenstand der Naturwissenschaft ist, unterschieden wird. (65f.) Während der Körper in einem flächenhaltigen messbaren Raum zu verorten ist, sind der Leib wie auch die Atmosphären flächenlos (40, 66f.), woraus aber kein an die Philosophietradition anknüpfender Dualismus zwischen Leib und Körper abzuleiten ist. (67) Der Leib wird vielmehr durch „Einleibung“ mit dem Körper dynamisch zusammengeschlossen, was zum Beispiel dann ersichtlich wird, wenn „Bewegungssuggestionen“ der Musik den Leib ergreifen und sich auf die körperlichen Glieder beim Tanzen „übertragen“. (68) Schmitz gesteht ein, dass der Körper für die Funktionen des Leibes von Bedeutung ist, verweist aber mittels Phantomglieder oder Berichten von Nahtoderfahrungen auf die Möglichkeit, eines nicht notwendigen oder dauerhaften Zusammenhanges, (70) wobei er darüber hinaus keine „gültige Bestätigung“ bzw. eindeutig nachweisbare Kausalität vorliegen sieht, dass der Leib aufgrund körperliche Prozesse entsteht oder auf diese zu reduzieren ist. (69) Zur Beschreibung der menschlichen Lebenserfahrung ist für Schmitz einzig der Leib von Bedeutung, wobei der Körper vielmehr einen „sperrigen Block“ im „In-der-Welt-sein“ des Menschen darstellt. (70) Diese Einschätzung durchzieht Schmitz´ gesamtes Werk, in dem er bewusst auf die Einbeziehung von biologischen oder physikalischen Erkenntnissen der Naturwissenschaft verzichtet. Dagegen könnte der Vorwurf laut werden, dass der Leib zu autonom von körperlichen Prozessen verstanden wird. Wenn dieser Einwand auch nicht unbegründet ist, kann Schmitz´ Bestreben aber gerade auch als Widerstand gegen das reduktionistische und mittlerweile alltägliche Selbstverständnis des Menschen gelesen werden, welches die Lebenserfahrung auf Hormonausschüttungen oder neuronale Prozesse reduziert und damit das eigentliche Erleben auszuschalten droht.
In den Kapiteln sechs bis neun beleuchtet Schmitz die Zeit, die stets an das präpersonale wie auch personale Leben geknüpft ist. Die „primitive Gegenwart“ als „plötzlicher Einbruch des Neuen“, der zum Beispiel spürbar als engender Schreck leiblich erfahrbar wird, stiftet die „absolute Identität“ und legt damit den Grundstein zur „Selbstheit“. (74f.) Die vorhergehende selbstlose Weite, wie sie zum Beispiel am Kontinuum oder im Dösen nachzuvollziehen ist, wird durch die „primitive Gegenwart“ zerrissen in die Dauer als „Urprozess“ einer Bewegung zum untergehenden „Vorbeisein“ und einer Bewegung des „Fortwährens“ zum Neuen (83) und legt damit den Ursprung der Zeit. Schmitz richtet sich gegen die alltägliche Vorstellung, dass die Zeit eine alle Prozesse umfassende Bewegung sei und bezeichnet dessen vermeintlich gleichmäßiges Voranschreiten – wie es die Bewegung einer Uhr suggeriert – als bloßes Kunstprodukt. (Ebd.) Vielmehr soll die Zeitlichkeit an die Leiblichkeit der Person geknüpft und essentieller Bestandteil der Selbstfindung des Menschen sein. Die Dynamik des Leibes, so Schmitz, ahmt demnach die Strukturen der Zeit nach, wenn die gespürte „Enge“ die Richtung zum Vergehen und die „Weite“ das Fortschreiten in die Zukunft vermitteln soll. (Ebd.) Mit dem Eintritt der „absoluten Identität“ gliedert sich die „Weite“ in Situationen (75), die auch einen wesentlichen Anteil der Zeiteinheiten ausmachen sollen. (86) Die Verteilung der Dauer orientiert sich zum Beispiel an „zuständlichen“ oder „aktuellen“ Situationen. (84f., 91f.) Der Mensch ist durch die Sprache zur „Explikation“ oder „Vereinzelung“ fähig, um so aus den Situationen einzelne Bedeutungen zu individuieren und eine konkrete Einteilung der Zeit als „modale Lagezeit“ vorzunehmen, die aus der „Modalzeit“ einerseits und der „Lagezeit“ andererseits besteht. Die ursprünglichere „Modalzeit“ spaltet sich mit dem „Einbruch des Neuen“ in die Vergangenheit, als das, was nicht mehr ist, in die Zukunft, als das, was noch nicht ist und in die Gegenwart. (89, 93) Die „Lagezeit“ ist dagegen zu verstehen als Anordnung gleichzeitiger einzelner Ereignisse oder Daten in einer linearen Folge des Früheren zum Späteren. (Ebd.) Die Verbindung von „Lage“- und „Modalzeit“ zur „modalen Lagezeit“ macht sich der Mensch zunutze, indem er wie beim Gebrauch von Uhren die Dauer in Zeitstrecken mit jeweils einzelnen messbaren Zeitpunkten einteilt (79 ff.), was für die Orientierung des Menschen unerlässlich ist. Der „gewöhnliche Rhythmus des Lebens“ geschieht aber abschließend nicht in einem allumfassenden zeitlichen Rahmen oder einer Abfolge regelmäßig aufeinanderfolgender Zeitpunkte, sondern besteht in den immer wiederkehrenden „Einbrüchen des Neuen“, welche die fortwährende ruhende Dauer „zerreißen“ und durch welche sich der Mensch auf diese Weise immer wieder selbst finden soll. (91)
Diese zeitlichen Prozesse sind auch für das Personsein des Menschen von erheblicher Bedeutung. Im letzten Kapitel fasst Schmitz seine Erkenntnisse zum Prozess der Individuation des Menschen zusammen, die er aber nicht als Geburt in eine bereits vorhandene Welt begreift. (97) Auf der ersten Stufe der bloßen Selbstlosigkeit in der Weite des Kontinuums wird mit dem „Einbruch des Neuen“ wie beim affektiven Betroffensein durch den Schreck die absolute Identität gestiftet und gleichzeitig der Ursprung der Zeit gelegt. (97ff.) Aus der „primitiven Gegenwart“ resultiert die „leibliche Dynamik“ und die „leibliche Kommunikation“, mit der auch die Bildung von bedeutsamen Situationen einhergeht. (99f.) Die „leibliche Dynamik“ differenziert Schmitz nach ihrer Bindungsform zwischen gespürter Enge und Weite, die charakteristisch für die „leibliche Disposition“ der Person wird. Aus diesen Dispositionen werden Charaktertypen abgeleitet, die sich hinsichtlich der Offenheit oder Empfänglichkeit im Umgang mit Gefühlen oder Personen unterscheiden. (33ff.) Erst der Mensch, der über das Säuglingsalter hinausgegangen ist, kann dann auf einer nächsten Stufe mittels Sprache einzelne Bedeutungen aus der Situation explizieren und sich so auf andere Weise in seiner Umgebung zurechtfinden. (101 f.) Erst auf diesem Niveau ist es möglich, von einer Person zu sprechen, die in der Lage ist, sich in einem „Netz von Gattungen“ als Etwas zu verstehen und sich zum Beispiel anhand von bestimmten Rollen zu verorten oder selbst zu bestimmen. (104) Das „Sammelbecken“ als Ort der explizierten vereinzelten Bedeutungen und Gattungen bildet daran anschließend auf einer vierten Stufe die „Welt“, die nicht statisch vorhanden ist, sondern erst mit dem fragenden Explizieren der Person entsteht. (104f., 110) Die labile Person steht in diesem Zusammenhang vor der Aufgabe, sich zwischen „personaler Regression“ wie im „affektiven Betroffensein“ und „personaler Emanzipation“ in kritischer Distanz zur Betroffenheit zurechtzufinden. (106ff.) Damit einher geht auch die immer fortwährende Bildung der „persönlichen Eigenwelt“, die sich aus den Bedeutungen ergibt, welche für die Person durch die unmittelbare Betroffenheit subjektiv sind, während die „persönliche Fremdwelt“ alle Bedeutungen umfasst, die durch Abstandnahme in der personalen Emanzipation objektiviert sind. (Ebd.)
Schmitz greift bei der Darstellung seiner Thesen auf sein umfassendes Werk zurück, um in aller Kürze und mit teilweise auffälligen Wiederholungen – bedingt durch seine Erblindung (10) – im Stil eines Vortragenden der Thematik der Selbstwerdung gerecht zu werden. Zwar wirken seine Formulierungen an einigen Stellen gedrängt und verlangen nach mehr Ausführlichkeit, jedoch sind seine Überlegungen bereits detaillierter in seinem opus magnum, dem „System der Philosophie“, angelegt und in zahlreichen Büchern weiterentwickelt. Schmitz spürt dem, was andere Philosophen wie selbstverständlich voraussetzen – dass sich der Mensch „immer schon“ in einer Welt vorfindet – akribisch nach, indem er auch den Zugang zur Welt auf der Basis strenger, phänomenologischer Begriffe beleuchtet.
Dabei scheinen seine Überlegungen in die Nähe eines Idealismus zu rücken, wenn er die Zeit stets an die Leiblichkeit knüpft und auch die Entstehung der Welt an eine explizierende Person gebunden ist. Betroffenheit wie auch die Explikation der Person sind fundamentale Bestandteile der Weltentstehung im obigen Sinne, weshalb „Selbstwerdung“ auch immer Weltwerdung mit meint. Es wäre jedoch voreilig, Schmitz´ Weltbegriff als eine Form des traditionellen Idealismus zu deuten, von dem er sich nämlich explizit abgrenzen möchte. Den „naiven Idealismus“, der den Geist des Menschen in der Rolle des „Weltbaumeisters“ übertrieben haben soll, will Schmitz mit seiner Konzeption gerade überwinden. (108) Schmitz schreibt dem Menschen keine Schöpferqualitäten zu,[1] gesteht aber ein, dass die Person durch „eigene Zusätze“ wie im bereits erwähnten Uhrengebrauch die Welt „vervollständigen“ oder zu ergänzen versucht. (108) Daneben muss auch klar sein, dass bei der Explikation der Person keine Welt aus dem Nichts konstruiert wird, denn die explizierte Bedeutsamkeit ist immer primär[2] und liegt bereits „chaotisch mannigfaltig“ vor, ist aber ohne die Leistung der Person noch nicht vereinzelt, weshalb sich Schmitz´ Konzeption auch gegen ein konstruktivistisches Weltverständnis richtet. Dass etwas existiert, ist damit nicht vollständig an die Explikationsleistung der Person gebunden.
Dass die Person aus der Weltwerdung nicht wegzudenken ist, kann sich auch auf das Philosophieverständnis des Autors zurückführen lassen. Philosophie definiert dieser von Beginn seines Schaffens an als „Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung“.[3] Einen objektiven oder distanzierten „Blick von Nirgendwo“, wie Schmitz mit Rückgriff auf Thomas Nagel formuliert (20f.), der gänzlich unabhängig von einer Person besteht, sucht man bei diesem „Sichfinden“ des Menschen vergeblich, denn affektives Betroffenensein des Leibes oder fragendes Explizieren in einer bestimmten Situation sind unhintergehbare Bestandteile des menschlichen Lebens. Schmitz fundamentaler phänomenologischer Anspruch, diese Facetten der Lebenserfahrung herauszustellen, spiegeln sich gerade in seinem Weltverständnis wider, dass sich auch deshalb unvereinbar mit dem Naturalismus von diesem unterscheidt.
Seine Konzeption ist aber auch kaum mit dem Weltverständnis des „Neuen Realismus“ vereinbar wie ihn Markus Gabriel prominent zu begründen versucht und der sich damit ebenfalls gegen die Vorherrschaft des Naturalismus behaupten will.[4] Schmitz´ Buch „Gibt es die Welt?“[5] kann zumindest dem Titel nach als unausgesprochene Antwort auf Gabriels zuvor erschienenes Werk „Warum es die Welt nicht gibt“ gelten, aber auch anderweitig stellte er immer wieder Bezüge her. (51f.)[6] Gabriel richtet sich gegen die These, dass es eine Welt als absolute Totalität geben könnte, weil man stets unfähig ist, diese vollständig zu beschreiben.[7] Stattdessen will er im Rahmen seiner „Sinnfeldontologie“ zeigen, dass Gegenstände in unzähligen „Sinnfeldern“ vorkommen und das die Rede von Existenz bedeutet, dass etwas in einem solchen „Sinnfeld“ „erscheint“.[8] Im Vergleich zu diesem Ansatz bekämpft auch Schmitz einen Weltbegriff, der traditionell als einheitliche und absolute Totalität postuliert wird, verwendet dabei aber grundsätzlich andere Mittel. Dass es primär Gegenstände sein sollen, welche ein Sinnfeld ausfüllen, muss für Schmitz aufgrund seines phänomenologischen Anspruchs befremdlich wirken. Denn er will primär gerade nicht von bloßen Gegenständen ausgehen, sondern von ganzheitlichen Situationen, aus denen erst sekundär einzelne Bedeutsamkeit und nicht vordergründig Gegenstände individuiert werden. Daher müsste für ihn auch anstatt vom „Erscheinen“ von der „Explikation“ die Rede sein, die eng an die Leistung der Person und der Selbstwerdung gebunden ist, aber in Gabriels Überlegungen kaum eine Rolle spielen. Während dieser in seiner Ontologie den Weltbegriff verabschieden will und deshalb auch das „Zur-Welt-Kommen“ des Menschen nicht im Blick hat, versucht Schmitz´ das traditionelle Weltverständnis durch ein neues zu ersetzen. Bei allen Unterschieden zwischen den Autoren verfolgen aber beide immerhin eine gemeinsame Absicht: Denn neben der Kritik am Naturalismus richtet sich Gabriels philosophisches Vorhaben auch gegen einen radikalen Konstruktivismus[9], weshalb eine Verständigung zwischen den Autoren nicht von vorneherein auszuschließen, sondern vielmehr ertragreich sein kann.
Schmitz versucht in seinen Beiträgen zur „Geschichte der Selbstwerdung“ und der damit einhergehenden Weltentstehung, sowohl den Realismus als auch den Idealismus hinter sich zu lassen. Weder die Person noch die Welt sind einfach statisch vorhanden, wenn die erstere immer wieder durch spürbare Erfahrungen auf sich aufmerksam wird, um letztere erst durch Sprache für sich und andere ersichtlich zu machen. Unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung vermag Schmitz es so, stufenartig die Geschichte der Selbstwerdung und damit auch die Grundlagen der Person aufzuzeigen.
[1] Hermann Schmitz, Wozu philosophieren? (Freiburg/München: Karl Alber, 2018), 94.
[2] Hermann Schmitz, Adolf Hitler in der Geschichte (Bonn: Bouvier, 1999), 27.
[3] Hermann Schmitz, System der Philosophie Bd. 1: Die Gegenwart (Bonn: Bouvier 2005 [1964]), 14.
[4] Vgl. Markus Gabriel, Sinn und Existenz (Berlin: Suhrkamp 2016), 89-94.
[5] Für den Bezug zu Gabriel vgl. Hermann Schmitz, Gibt es die Welt? (Freiburg/ München: Karl Alber 2014), 21, 26.
[6] Vgl. zum Beispiel Hermann Schmitz, Ausgrabungen zum wirklichen Leben (Freiburg/München: Karl Alber 2016), 245.
[7] Eine Möglichkeit, dies zu beweisen, entwickelt Gabriel mit dem „Listenargument“. Vgl. Gabriel, Sinn und Existenz, 45ff.
[8] Vgl. z.B. Gabriel, Sinn und Existenz, 163f., 173f., 183f.,191f., 193f.
[9] Vgl. Gabriel, Sinn und Existenz, S. 34f., 174f.
 Situations and atmospheres in organizations: A (new) phenomenology of being-in-the-organization
Situations and atmospheres in organizations: A (new) phenomenology of being-in-the-organization
Reviewed by: Silvia Donzelli (Humboldt-Universität zu Berlin)
In der gegenwärtigen Organisationsforschung lässt sich eine eindeutige Tendenz zur Aufwertung emotionaler Phänomene aufspüren. Hierbei liegt der Fokus primär auf dem Zusammenhang zwischen dem emotionalen Befinden der Organisationsteilnehmer und derer Leistungsfähigkeit, was die Frage nach der Beeinflussbarkeit von Gefühlen und Stimmungen im Bereich von Organisationen mit sich bringt. Während Begriffe wie Stimmung und Atmosphäre in der Management-Literatur zunehmend verwendet werden, bleibt jedoch eine systematische und theoretisch fundierte Untersuchung der Atmosphären bislang ein Desiderat der Organisationsforschung. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass das mehrseitig anerkannte Potenzial der Phänomenologie als Methode in der Organisationsforschung bisher nur spärlich ausgeschöpft wurde.
Aus diesem Hintergrund heraus versteht sich das Buch von Christian Julmi als ein Beitrag sowohl zur Organisationsforschung, als auch zu den phänomenologischen Studien. In seinem Buch nimmt sich Julmi vor, die Neue Phänomenologie als theoretische Basis für die Erforschung der Entwicklungsdynamiken von Situationen und Atmosphären in Organisationen fruchtbar zu machen. Das Ergebnis ist eine konsequente und systematisch aufgebaute Studie, die nicht so sehr darauf abzielt, absolutes Neuland zu betreten, als bereits bestehende Ergebnisse aus der Neuen Phänomenologie und aus der Organisationsforschung zu integrieren und wechselseitig anzureichern.
Die Studie ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die phänomenologischen Grundlagen dargelegt, welche den theoretischen Rahmen der Untersuchung bilden. Dabei orientiert sich der Autor in erster Linie an der Neuen Phänomenologie von Hermann Schmitz, deren Grundbegriffe er ausdrücklich übernimmt und mit einigen wichtigen Aspekten aus Guido Rappes Arbeit integriert. Die in der Philosophie von Hermann Schmitz zentralen Theorien des gespürten Leibes und der Gefühle als Atmosphären werden pointiert umrissen und durch die von Rappe stammenden und für das Verständnis der Sozialisationsprozesse wichtigen Begriffe von Lust und Unlust, Spontaneität, Responsivität und Reflexivität des Leibes angereichert. In diesem ersten, theoretischen Teil wird darüber hinaus auf die Bedeutung leiblicher Kommunikation für die Bildung sozialer Situationen eingegangen und die konkreten Mechanismen, durch die sich diese vollzieht, in ihren Grundzügen vorgestellt.
Im zweiten Teil begibt sich Julmi zum Kern der Untersuchung und geht der Frage nach, wie sich gemeinsame Situationen und Atmosphären in Organisationen entwickeln. Eine zentrale Rolle wird der Kommunikation, verstanden als leibliche Kommunikation und damit als Austausch von Ausdrücken, beigemessen. Sie bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung gemeinsamer Situationen, welche wiederum von den Organisationsmitgliedern atmosphärisch wahrgenommen werden. Basierend auf die im ersten Teil umrissenen Dimensionen der lebensweltlichen Erfahrung, nämlich Enge und Weite sowie Lust und Unlust, unterscheidet Julmi verschiedene Formen der leiblichen Kommunikation. Insbesondere die antagonistische und wechselseitige Führungskommunikation, mit ihrem Wechselspiel von Impulsen und Reaktionen des Führens und Geführt-werdens, öffnet den Spielraum für die Entwicklung sozialer Beziehungen und somit gemeinsamer Situationen. Die aus der Kommunikationsdynamik der ersten Begegnungen zwischen Organisationsmitgliedern sich bildenden leiblichen Beziehungen sind für den Sozialisationsprozess grundlegende Erfahrungen, aus deren Regelmäßigkeit Erwartungshaltungen erwachsen und sich Konventionen und Rituale herausbilden. Die unterschiedlichen Situationen in der Organisation und ihre atmosphärische Wahrnehmung werden als Schlüsselpunkte eines Gestaltkreises, also eines hermeneutischen Zirkels dargestellt, in dem neben der leiblichen Kommunikation – die in Julmis Arbeit ohnehin die prominenteste Rolle spielt – auch die Gestaltung des physischen Raumes und dessen atmosphärische Wahrnehmung mitwirken.
Während im zweiten Teil des Buches der Themenkomplex der Situationen und Atmosphären in der Organisation untersucht wird, geht es im dritten Teil um die Frage danach, ob es eine übergreifende Situation der Organisation gibt, und dementsprechend um ihre atmosphärische Wahrnehmung. In diesem Zusammenhang integriert Julmi die in der Managementforschung weit verbreiteten Begriffe Organisationskultur und Organisationsklima mit den von ihm herausgearbeiteten situativen und atmosphärischen Konzepten. In (modifizierender) Anlehnung an Edgar Scheins Modell der Kulturebenen definiert Julmi die Organisationskultur als die Gesamtheit sowohl der sichtbaren, also der räumlichen und situativen, als auch der nicht-sichtbaren Artefakte, nämlich der geteilten Werte und Konventionen. Grundsätzlich werden in Bezug auf die Bildung von Organisationskultur und -Klima ähnliche Dynamiken erörtert, die Julmi im zweiten Buchteil für die Interpretation situativer und atmosphärischer Phänomene auf der binnenorganisationalen Ebene herausarbeitet. Besonders hervorgehoben wird hierbei die fundamentale Rolle der Dimension der Lust (Attraktion) als Medium für die Kohäsion der Organisationsmitglieder und für ihre Identifikation mit der Organisationskultur.
Der Buchinhalt ist im Wesentlichen aus Atmosphären in Organisationen: Wie Gefühle das Zusammenleben in Organisationen beherrschen entnommen, einer umfangreicheren, 2015 erschienenen Veröffentlichung desselben Autors. Wichtige Auszüge aus diesem Buch sind nun, überarbeitet und ins Englische übersetzt, in Situations and Atmospheres in Organisations eingeflossen, wobei der Text in dieser Form – obwohl er leider unter anderem des interessanten philosophiehistorischen Streifzugs über den Atmosphärenbegriff entbehrt – das Interesse eines breiteren Publikums wecken dürfte.
Besonders erfreulich ist bei der Lektüre von Situations and Atmospheres in Organisations die interdisziplinäre Herangehensweise, mit der die neuphänomenologische Leibphilosophie unter Berücksichtigung umweltpsychologischer, anthropologischer und soziologischer Ansätze für die Interpretation einer Vielfalt an für die Organisationen relevanten Phänomenen angewendet wird. Dabei dürften, bei der klaren und konzisen Darstellung, die im ersten Buchteil umrissenen neuphänomenologischen Begriffe nicht nur für das philosophische Fachpublikum verständlich werden. Obwohl man hier hinzufügen muss, dass einige Begriffe aus der Philosophie von Schmitz auch für den mit der phänomenologischen Herangehensweise vertrauten Leser an sich problematisch sein können. In diesem Sinne ist es schade, dass Julmi in seinem Buch nicht die Gelegenheit ergreift, den Atmosphärenbegriff von Hermann Schmitz, sei es auch nur in Bezug auf manche Aspekte, kritisch zu hinterfragen. Der an der Forschung von Emotionen und Atmosphären interessierte Leser wird in Julmis Buch vergeblich nach einer auch nur angedeuteten kritischen Stellung zur theoretischen Welt von Hermann Schmitz suchen. Das wäre zum Beispiel bezüglich des von Schmitz postulierten und von Julmi übernommenen Begriffs der Autorität der Atmosphären denkbar, wie die Kritik von Jens Soentgen bemerkt hat.
Allerdings täte man Julmi unrecht, ein Defizit an kritischer Perspektive zu überbetonen, nicht zuletzt weil er, wie gesagt, in seiner Darlegung der neuphänomenologischen Grundlagen auch einige wichtige Begriffe aus Rapps Arbeit mit einbezieht und damit eine erweiterte neuphänomenologische Theorie aufgreift.
Auf das Thema kritische Stellung geht Julmi selbst im Fazit seines Buches ein: „However, the study´s integration achievement by no means implies that it does not take a critical perspective. On the contrary, all approaches are rejected for which organizational coexistence is based primarily on rational considerations and intentions“ (134).
Das ist eine klare Aussage, die Vieles über den argumentativen Aufbau des Buches, aber auch über seine Stärken und eventuelle Schwächen verrät.
Zweifellos ist es ein Verdienst der Phänomenologie, durch die Anerkennung der leiblichen Erfahrung als primäre Form der Welterkenntnis und der Interaktion, auch das Nicht-Rationale, Ungeplante und Unwillkürliche aufgewertet zu haben. Für die Untersuchung der Entwicklung relationaler Dynamiken und gemeinsamer Situationen ist die Bedeutung unwillkürlicher Phänomene kaum zu überschätzen. In der Tat sind die Ausführungen Julmis zu den Dynamiken der leiblichen Kommunikation besonders ertragreich. Seine tiefgreifende Ausarbeitung unterschiedlicher Formen der leiblichen Kommunikation, des Austausches von Ausdrücken als nicht-sprachlichen Botschaften – durch Blicke, Körperhaltungen, Bewegungen, Tonfall, aber auch durch Verhaltensweisen, wie zum Beispiel dem häufigen Ergreifen des Wortes – erlaubt, vielen Phänomene des Alltags und des organisationalen Lebens Rechnung zu tragen. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass durch nicht-sprachliche Kommunikation wesentlich mehr Mitteilungen ausgetauscht werden, als durch sprachliche Kommunikation – schreibt Julmi im Kapitel 6.1 seines Buches (53). Dieser Grundgedanke leitet sein Verständnis der leiblichen Kommunikation als fundamentale Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Beziehungen.
Aus dieser Perspektive heraus wird auch das Phänomen Leadership erklärt. An mehreren Stellen präzisiert Julmi, welche Auffassung von Leadership seine Arbeit zugrunde legt: es geht um die bei der Kommunikation eingenommene führende Position, den Enge-Pol, welcher die leibliche Kommunikation zusammenhält und lenkt. Das schließt die Möglichkeit ein, dass die Führungsposition innerhalb eines Gesprächs von verschiedenen Teilnehmern abwechselnd eingenommen wird (wechselseitige Führungskommunikation). Nach dieser Auffassung entsteht Leadership primär aus dem zumeist unwillkürlichen Spiel der antagonistischen Tendenzen der Einleibung: Enge und Weite, Lust und Unlust. Das ist, in Hinblick auf das erwähnte Verständnis von Leadership als Führungsposition in der Kommunikation, durchaus überzeugend.
Einige Schwierigkeiten ergeben sich jedoch, wenn Julmi eine andere Deutung des Leadership-Begriffs anstreift – und das ist unvermeidlich, in einem Buch über Organisationen – nämlich die formale, strukturelle Rolle innerhalb einer Institution. Im Kapitel 6.2. möchte Julmi die Macht leiblicher Kommunikation anhand folgenden Beispiels veranschaulichen: wenn jemand einen Raum mit gesenkten Schultern betritt, wird er es schwierig haben – und zwar unabhängig von seiner formalen Rolle – den Respekt der Anwesenden zu erlangen (56). Diese Aussage ist nicht unanfechtbar. So groß die Bedeutung der leiblichen Kommunikation auch sein mag, sind Fragen zum gegenseitigen Respekt im beruflichen Umfeld nicht allein und nicht primär darauf angewiesen. Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass ein selbstbewusster Organisationsleader – unabhängig davon, ob er seine Führungsposition mit Charisma oder eher Einschüchterung untermauert – sich gesenkte Schultern und viele weitere lässige Körperhaltungen leisten kann, ohne dabei an Respekt, Ausstrahlung oder Autorität einzubüßen.
Hier tritt ein möglicherweise problematischer Aspekt des Buches zu Tage: bei seiner Bemühung, die Bedeutung der leiblichen Kommunikation aufzuwerten und die Rolle rationaler und intentionaler Prozesse in den Hintergrund treten zu lassen, scheint der Autor an manchen Stellen die relationalen Phänomene lediglich im Lichte unwillkürlicher Dynamiken erklären zu wollen. Nun ist der Fokus auf die leibliche Kommunikation bei der Erforschung von Organisationen ein durchaus legitimer und, wie es in Julmis Buch der Fall ist, origineller und fruchtbarer Ansatz. Doch bei manchen relationalen Dynamiken ist die leibliche Dimension so eng mit anderen relevanten Faktoren verstrickt, dass diese nicht einfach ausgeklammert werden können. Bei der Erklärung von Phänomenen im beruflichen Kontext könnte diese Strategie möglicherweise zu kurz greifen.
Es wäre zum Beispiel interessant gewesen, das Verhältnis zwischen Leadership, verstanden als Führungsrolle bei der leiblichen Kommunikation, und der formalen Leadership als struktureller Rolle innerhalb der Organisation – also zwischen der unwillkürlichen, auf leiblichem Spüren basierten Machtsuggestion und der institutionalisierten Machtausübung – genauer zu beleuchten. In der Tat sind beide Begriffe nicht immer eindeutig auseinander gehalten. Julmi anerkennt die Bedeutung der formalen Macht, doch lediglich im Rahmen der autoritären Führung, die sich in Machtinstrumenten wie Belohnung, Bestrafung und Bedrohung konkretisiert (58). Die charismatische Führung basiert hingegen auf der Faszination, die bei der leiblichen Kommunikation vom Leader ausstrahlt, und zwar unabhängig von seiner formalen Macht. Bei der machiavellischen Frage, ob es für einen Leader besser sei, geliebt oder gefürchtet zu werden, würde Julmi wahrscheinlich für ersteres plädieren, da er in der Attraktion die notwendige Voraussetzung für die Bildung gemeinsamer Situationen und gemeinsamer Perspektiven sieht. Inwiefern die charismatische leibliche Kommunikation, in Ermangelung formaler Macht, Spielräume für die tatsächliche Machtausübung in einer Organisation ermöglicht, bleibt jedoch eine offene Frage.
Dass die von Julmi erwähnten großen Büros und großen Tische die Macht des Leaders visualisieren, ist bekannt (56). Freilich sind solche raumgestalterischen Elemente, die zur atmosphärischen Wahrnehmung des physischen Raumes beitragen, weder ungeplant noch unwillkürlich: im Gegenteil wird ihre Wirkung auf die Besucher sorgfältig einstudiert. Das ist, wie Gernot Böhme in Bezug auf den Bühnenbildbau bemerkt hat, ein Beweis dafür, dass räumliche Atmosphären absichtlich erzeugt werden können. Aber auch die Wahrnehmung dieser Einrichtungen – und das gilt insbesondere im beruflichen Kontext – ist keineswegs unwillkürlich. Beim Betreten einer Firma wissen wir, dass man durch die Größe versucht, uns zu imponieren. Hierbei sind wir keineswegs unserem leiblichen Spüren ausgeliefert, wir können ihm sogar durch eine reflektierte Haltung entgegentreten. In ähnlicher Weise ist auch die zwischenmenschliche leibliche Kommunikation nur bedingt unwillkürlich und unlenkbar. Im Gegenteil – und trotz der Zweifel Julmis daran, dass ein simulierter Ausdruck als authentisch wirken kann (79) – sind ausgerechnet bei Organisationen sowohl der Ausdruck, als auch dessen Rezeption und die Reaktion darauf oft sorgfältig einkalkuliert, inszeniert, möglicherweise auch vorgetäuscht. Nicht selten stehen auf den großen Schreibtischen der Organisationsmanager Bücher über emotionale Intelligenz und nicht-sprachliche Kompetenz.
Davon abgesehen, sind die Ausführungen Julmis zur Rolle der Attraktion für die Bildung und Festigung sozialer Beziehungen von großem Interesse. Die Entwicklung gegenseitiger Erwartungen und Verhaltensmuster in gemeinsamen Situationen, die Prozesse der Angleichung und Ausgleichung, sowie die Phänomene der Imitation und Assimilation als Mittel der gegenseitigen Anpassung werden sorgfältig und aufschlussreich dargestellt. Über emotionale Konvergenz, Zugehörigkeitsgefühl und group thinking werden anregende Einsichten vermittelt, die auch über die Grenzen der Organisationsforschung hinweg für die Analyse von Gruppendynamik und kollektiven Handlungen von Bedeutung sind.
Die Dimensionen von Lust und Unlust, von Attraktion und Abgrenzung werden in Situations and Atmospheres in Organisations besonders gewichtet. Die lustvolle Annäherung führt zur Bildung der Gemeinschaft, und die Gemeinschaftszugehörigkeit wirkt sich lustvoll auf die situative Atmosphäre aus. Das ermöglicht die zunehmende Kohäsion der Organisationsmitglieder, die auch durch die unlustvolle Abgrenzung von Außenstehenden – zum Beispiel, von anderen Organisationen - verstärkt wird. Es kann sich sehr angenehm anfühlen, Teil einer Gemeinschaft zu sein. So sehr, dass das lustvolle Zugehörigkeitsgefühl den Vorrang gegenüber anderen relationalen Aspekten gewinnen kann. Zum Beispiel kann nicht mehr von Belang sein, welche Ansichten die anderen Mitglieder eigentlich vertreten: Hauptsache gehört man zusammen (88). Das ist eine äußerst einleuchtende Beobachtung, die Vieles über Gruppendynamik aussagt. Sicherlich kann ein ebensolcher Prozess der Anpassung sehr wichtig für die Kohäsion einer Gemeinschaft sein. Dass der damit implizierte Verzicht auf die Ausübung kritischer Fähigkeit (welche eben nicht immer lustvoll ist), freilich erhebliche Folgen haben kann, soll hier nicht weiter diskutiert werden.
Bezüglich der primären Bedeutung, welche im Buch der lustvollen Anziehung beigemessen wird, könnte man fragen: ist es wirklich so, dass gemeinsame Situationen eigentlich auf Attraktion beruhen? Sind die Prozesse der lustvollen Annäherung der Organisationsmitglieder, der Teilung gemeinsamer Werte und der Identifikation nur mögliche Entwicklungswege der gemeinsamen Situation oder sind sie doch, wie Julmi glaubt (115), notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme an der Organisationskultur?
Eine unlustvoll konnotierte gemeinsame Situation gleicht einer Kontradiktion, schreibt der Autor im Kapitel 7.4 und führt das Beispiel eines längst verheirateten, stets streitenden Paares (82). Beide teilen eine gemeinsame Situation, die ihre Identität prägt, und doch ist ihre leibliche Kommunikation durch abgrenzendes, unlustvolles Verhalten charakterisiert. Für die Betroffenen besitzt eine solche Situation, bemerkt Julmi, eine gewisse Tragik. Nun mag das im Fall des verheirateten Paares gelten. Das gilt aber vor allem deshalb, weil es sich um eine private und intime Beziehung handelt. Bei Organisationen geht es jedoch, bei aller Nähe und Identifikation mit den gemeinsamen Werten und Visionen, letztlich um eine berufliche Beziehung. Eine tiefgreifende und originelle Anthropologie des Leibes, wie die von Julmi es ist, könnte den Unterschied zwischen privat und beruflich im Umgang mit den Kräften des leiblichen Spürens lohnend berücksichtigen.
Literaturhinweise:
Böhme Gernot (2013) Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Berlin: Suhrkamp
Großheim Michael, Volke Stefan (Hrsg) (2010) Gefühl, Geste, Gesicht. Zur Phänomenologie des Ausdrucks. Freiburg/München: Karl Alber
Julmi Christian (2015) Atmosphären in Organisationen. Wie Gefühle das Zusammenleben beherrschen. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag
Julmi Christian, Scherm Ewald (2012) Der atmosphärische Einfluss auf die Organisationskultur: ein multidisziplinärer Ansatz, in: SEM Radar 11 (2/2012), S. 3-37
Schmitz Hermann (2014) Atmosphären. Freiburg/München: Karl Alber
Schmitz Hermann (2009) Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie. Freiburg/München: Karl Alber
Schöll Raimund, Atmosphärische Intelligenz. Anmerkungen eines Management-Coaches. in: Zeitschrift Führung + Organisation 76 (6/2007) S. 326-332
Soentgen Jens (2011) 5 Thesen zur Schmitz´schen Gefühlphilosopie. Unter: https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/1577
[:en]Publisher Page[:]
 Ausgrabungen zum wirklichen Leben. Eine Bilanz.
Ausgrabungen zum wirklichen Leben. Eine Bilanz.
[en:]Reviewed by: Corinna Lagemann (Freie Universität Berlin)[:de]Rezension von: Corinna Lagemann (Freie Universität Berlin)[:]
Der Kieler Philosoph Hermann Schmitz (geb. 1928 in Leipzig) nimmt sicherlich eine besondere Rolle in der Theoriebildung des 20. Jahrhunderts, insbesondere in der Phänomenologie ein. Angetreten in den späten 50. Jahren mit dem ausdrücklichen Ziel “den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen”, d.h. “nach Abbau geschichtlich geprägter Verkünstelungen die unwillkürliche Lebenserfahrung zusammenhängender Besinnung zugänglich zu machen”[i], blickt er nun auf ein reiches Werk von über 50 Monographien sowie über 150 Aufsätzen zurück. Als Ausgangspunkt für sein Schaffen nennt Schmitz immer wieder die Auswirkungen eines verhängnisvollen Paradigmenwechsels des menschlichen Welt- und Selbstverständnisses, den er in der griechischen Antike verortet und der in den noch heute teilweise vorherrschenden Leib-Seele-Dualismus geführt habe. Sein umfangreiches, teilweise schwer zugängliches Werk darf man als Projekt verstehen, mit diesen Auswirkungen aufzuräumen; hier sieht Schmitz ein entscheidendes Versäumnis der Phänomenologie, in deren direkter Nachfolge er sich sieht; er ist der Begründer der sogenannten Neuen Phänomenologie.
Das Ziel des vorliegenden Bandes ist es, so Schmitz, “einige Fronten aufzuzeigen, an denen sich mein Kampf gegen die überlieferten Verkrustungen vermeintlicher Selbstverständlichkeit abspielt, um die wichtigsten Stoßrichtungen meiner Ausgrabungen zum wirklichen Leben zu markieren”[ii]. Durch die angemessenen Verbesserungen und Präzisierungen verschiedener Punkte möge das Buch auch für Kenner des Frühwerks ergiebig sein; gleichzeitig beansprucht Schmitz, dass es eingängig sei und sich damit auch für neue Leser seiner Theorie eigne.
Im Verlauf seines Werks haben sich seit den sechziger Jahren vier Hauptlinien seiner Theorie herauskristallisiert, denen jeweils ein Hauptkapitel des Bandes gewidmet ist. Somit erfolgt eine Rekonstruktion und eine kritische Revision des Gesamtwerks entlang seiner Hauptachsen.
Die ersten beiden Kapitel – Subjektivität und Mannigfaltigkeit – stehen sachlich in einem engen Verhältnis; so ist das Kapitel zur Subjektivität auch sehr kurz gehalten. Es handelt sich um eines der frühesten und fundamentalen Konzepte des Schmitzschen Theoriegebäudes und mit Sicherheit auch um eines der komplexesten und am schwersten zugänglichen; so befasst sich der erste Band vom System der Philosophie (Die Gegenwart) (1964) mit diesem Thema. Hier wurden die meisten Korrekturen und Erneuerungen vorgenommen. Mit seiner intuitiv nicht ganz eingängigen Rede von den verschiedenen Formen der Mannigfaltigkeit beschreibt Hermann Schmitz die unterschiedlichen Stadien des Erlebens gemäß ihres Abstraktionsgrads. Das Mannigfaltige ist das, was der Mensch vor der Individuation einzelner Gegenstände an und um sich selbst erfährt. So unterscheidet Schmitz das chaotische Mannigfaltige vom numerischen, wobei sich ersteres in diffus und konfus unterteilen lässt. Chaotische Mannigfaltigkeit ist ein Zustand ohne Identität und Verschiedenheit, d.h. ein reines gleichförmiges Durcheinander, innerhalb dessen der Mensch sich orientieren muss. Als Beispiel nennt Schmitz das Wasser, das einen Schwimmer umgibt oder den Zustand des Dösens, der die Umgebung verschwimmen lässt. Die Unterteilung in die Subtypen ‘konfus’ und ‘diffus’ wurde nach den Ausführungen im System vorgenommen; damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es ein breites Spektrum dieser Art(en) von Mannigfaltigkeit gibt. So ist das Wasser, das den Schwimmer umgibt, homogen und entbehrt jeder Form von Identität und Verschiedenheit, was mit dem Begriff der konfusen Mannigfaltigkeit bezeichnet wird. Die spürbaren Körperbewegungen des Schwimmers, oder auch Kaubewegungen[iii] sind immer noch nicht vereinzelbar, jedoch verfügen diese über ein gewisses Maß an Verschiedenheit in der Form, dass sie sich spürbar vom Hintergrund abheben und bewusstgemacht werden können. Bei dem numerischen Mannigfaltigen – im Frühwerk zählbares Mannigfaltiges – handelt es sich um den (leibfernen) Bereich des Zählbaren und der Mathematik.
Allein durch die Unterteilung der chaotischen Mannigfaltigkeit in ihre Subtypen gewinnt die Analyse gegenüber der Ursprungsversion von 1964. Nach der Überwindung des erheblichen Lesewiderstands ermöglicht dieses Konzept eine genaue und treffende Beschreibung des Kontinuums menschlicher Verhaltungen, von den basalen Bewusstseinsschichten bis hin zu dem größtmöglichen Grad an Abstraktion.
Hier schließt die Theorie der Leiblichkeit an, eine weitere zentrale Säule in Schmitz’ Gesamtkonzeption, die im dritten Kapitel des Bandes entfaltet und umfassend gewürdigt wird. Im leiblichen Spüren liegt die Wurzel der Selbstzuschreibung, einem ersten rudimentären Selbstbewusstsein und die “Zündung der Subjektivität”. Über die identifizierbare Selbstzuschreibung, die im eigenleiblichen Spüren begründet liegt, können Identität und Verschiedenheit in die Mannigfaltigkeit gebracht werden, dergestalt, dass der Mensch (Schmitz: “Bewussthaber”) sich selbst als Zentrum seines Erlebens wahrnimmt und sich in der Welt verorten und sich zu ihr verhalten kann. Dies realisiert sich im affektiven Betroffensein (sic), wenn der Mensch etwas am eigenen Leibe spürt, sich ergriffen oder betroffen fühlt, “wenn der plötzliche Andrang des Neuen Dauer zerreißt, Gegenwart aus ihr abreißt und die zerrissene Dauer ins Vorbeisein entlässt (primitive Gegenwart (…)).”[iv] Hier wird bereits der zeitliche Aspekt von Leiblichkeit angedeutet, der in Schmitz’ Konzeption eine große Rolle spielt, in diesem Band allerdings erst im Zusammenhang mit Welt wieder aufgegriffen wird.
Die Leibkonzeption ist seit den Anfängen im zweiten Band des Systems (1965 und 66) weitgehend unverändert; im vorliegenden Band findet sich eine pointierte, gleichwohl umfassende Beschreibung der zentralen Begriffe (leibliche Dynamik, leibliche Kommunikation, etc.). Allein die Beispiele, die Schmitz wählt, etwa um die leibliche Dynamik zu charakterisieren, sind bisweilen problematisch und nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. So ist etwa im Zusammenhang mit den leiblichen Regungen von der Angstlust die Rede, und von Menschen, die z.B. die Achterbahn als angsterregende Situation aufsuchen, um sexuelle Erregung zu spüren; auch die Erwähnung der mutmaßlich schmerzfreien Geburt ist im Zusammenhang mit der Gewichtsverschiebung im vitalen Antrieb fragwürdig. Hier beruft sich Schmitz auf den Mediziner G.D. Read und bescheinigt den „innerlich vollkommen vorbereiteten Frauen (…) nur sehr geringe oder gar keine Beschwerden“[v]. Allerdings hätten sie „ein gutes Stück schwerer Arbeit zu leisten. Ihr Ächzen und Stöhnen sei das eines Mannes, der mit Erfolg an einem Seil zieht “ (Ebd.). Diese Beschreibung ist ebenso spekulativ wie anmaßend und wird damit dem zu beschreibenden Aspekt nicht gerecht.
Im Zusammenhang mit der Leiblichkeit wird in einem extra Unterkapitel dem Bereich der Gefühle besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In seiner Beschreibung der Gefühle als leiblich fundierte Atmosphären sieht Schmitz “ein jahrtausendealtes Missverständnis der Gefühle”[vi] überwunden, jenes Missverständnis nämlich, das die Gefühle einer privaten, unzugänglichen Innenwelt zuordnet. Indem er Gefühle als Atmosphären mit eigener räumlich-zeitlichen Struktur beschreibt, kann er sie als gleichsam in der Welt vorkommend, den Fühlenden übersteigend und intersubjektiv wirksame Mächte plausibel machen, die keinesfalls auf private Innenwelten beschränkt sein können. Sehr stark ist in diesem Kontext der Vergleich mit Wetter und Klima, ebenso wie seine sehr überzeugenden Beispiele, etwa die Wahnstimmung in der Schizophrenie, das Grauen, aber auch die Zufriedenheit und der ennui. Vor allem die Transformationsprozesse von reinen Stimmungen hin zu in einem bestimmten Gegenstand oder Sachverhalt zentrierten Gefühlen lassen sich so gut nachvollziehen.
Im vierten Kapitel öffnet sich der Fokus in Richtung Welt. Hermann Schmitz umreißt seinen Begriff der Welt als entfaltete Gegenwart, wie er dies in seinem Band Was ist die Welt? entwickelt hat; ein Konzept, das sich zwingend aus seiner Theorie ergibt und darin auch schon angelegt war, aber niemals explizit als ‘Welt’ dargelegt wurde. Die entfaltete Gegenwart ist gleichsam der Gegenbegriff zur bereits erwähnten primitiven Gegenwart. Stiftet diese nämlich im affektiven Betroffensein die Subjektivität, findet in der Entfaltung der Gegenwart nach Schmitz eine Abschälung jener Subjektivität statt und der Mensch gewinnt mehr und mehr Distanz zum Geschehen. Das Ergebnis der Entfaltung der Gegenwart ist die Welt: eine den Menschen übersteigende Ganzheit von Gegenständen, Sachverhalten und Möglichkeiten zur Vereinzelung. Dieses Konzept ergibt sich fast zwingend aus seinen bisherigen Überlegungen, expliziert wurde dieser Begriff erst kürzlich im Band Gibt es die Welt? (Alber 2014).
Der Band schließt mit einem vergleichsweise kurzen Kapitel zur Geistesgeschichte des Abendlandes ab; es schlägt den Bogen von dem heidnischen Altertum über das vorchristliche Jahrtausend hin zur Neuzeit. Dieses Kapitel kann als Rückblick auf die philosophiehistorischen Ausführungen verstanden werden, die Hermann Schmitz in verschiedenen Monographien, zuletzt in Der Weg der europäischen Philosophie (2009) ausführte. Gemessen an seinem inhaltlichen Umfang ist es mit 50 Seiten recht kurz und es schließt sachlich nicht an die vorangehenden Kapitel an. In den einleitenden Worten nennt Schmitz ‘Enthusiasmus und Melancholie’ als Triebfedern für dieses Kapitel, was einem bilanzierenden Alterswerk unbedingt zugestanden werden kann.
Was bleibt nun also als Bilanz? Die tatsächliche Überwindung der Mensch- und Weltspaltung? Die Relativierung eines einseitig akzentuierten Individualismus?[vii]
Immerhin kann man festhalten, dass Hermann Schmitz im Verlauf seines Werks ein entscheidender Beitrag zur phänomenologischen Forschung und auch zu zahlreichen anderen Disziplinen gelungen ist, für die seine (Wieder-)Entdeckung des Leibes und seine Auffassung der Gefühle als Atmosphären anschlussfähig und überaus fruchtbar waren, um nur zwei Beispiele herauszugreifen. So profitieren nicht nur Psychologie und Psychiatrie von seiner Theorie, auch für die Geographie, Sozial- und Rechtswissenschaften haben sich seine Analysen als anschlussfähig erwiesen. Mit den Ausgrabungen ist ein pointierter Rückblick auf ein äußerst ertragreiches Werk gelungen, der für Einsteiger und Kenner seines Werkes gleichermaßen empfehlenswert ist.
[i] Hermann Schmitz, Ausgrabungen zum wirklichen Leben. Eine Bilanz. Verlag Karl Alber, Freiburg i.Br. 2016. S.7.
[ii] Ebd., S.8.
[iii] Ebd., vgl. S.104.
[iv] Ebd., S.19.
[v] Ebd., S.170.
[vi] Ebd., S.225.
[vii] Ebd., S.368.